Ältere Nachrichten
Die Coronakrise belastet auch Schiffsbesatzungen in der internationalen Fahrt. Ansprechpartner der BG Verkehr stehen für Beratungen zur Verfügung.
Besatzungswechsel können oft nur verzögert und unter großen Schwierigkeiten durchgeführt werden. So kommen Einsatzzeiten an Bord von mehr als zehn Monaten vor. Zudem fehlt oft Planungssicherheit. Auch Landgänge in Häfen, beispielsweise zur Seemannsmission oder zu einem WLAN-Zugang, können von Quarantänevorschriften betroffen sein.

Einige Besatzungsmitglieder verlieren so die Möglichkeit, durch Internettelefonie ihre Kontakte zu Familienangehörigen oder Freunden zu pflegen. Das Einfühlungsvermögen der Vorgesetzten, niederschwellige Beratungsangebote und Austausch im Team können helfen, dem Druck standzuhalten.
Als Ansprechpartner für eine Beratung der Unternehmen, deren Beschäftigten mit diesen Problemen konfrontiert sind, steht die zuständige Aufsichtsperson der BG Verkehr gerne zur Verfügung. Ansprechpartner finden Sie auf der Website der BG Verkehr. Dieses Angebot ist ein Service der berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung für Reedereien mit Schiffen unter deutsche Flagge und/oder für Seeleute mit einer sog. Ausstrahlungsversicherung (deutsche Seeleute mit Wohnsitz in Deutschland auf Seeschiffen unter ausländischer Flagge).
Unter dem Seefahrermotto "Eine Hand für mich – eine Hand fürs Schiff" erklärt die BG Verkehr in ihrer neuen Broschüre, was Fischer bei der Arbeit auf ihren Schiffen beachten sollten. Viele praxisnahe Stichwörter und Hinweisboxen sowie anschauliche Bilder sorgen für einen schnellen Überblick zu den wichtigsten Themen.
Die Präventionsabteilung der BG Verkehr deckt in ihrer 24-Seiten Broschüre "Sicheres Arbeiten in der Fischerei – Gute Praxis für ein sicheres Arbeiten auf Fischereifahrzeugen" alle wichtigen Sicherheitsaspekte ab. Sicherheit fängt bei der körperlichen Verfassung an und erstreckt sich über viele Arbeitsbereiche an Bord. Deshalb geht der Leitfaden im Hauptteil auf die verschiedenen Aspekte der Arbeit auf einem Fischreifahrzeug ein, unter anderem der sichere Umgang mit dem Fanggerät und das Verarbeiten, Lagern und Löschen des Fangs.

Unfälle an Bord zu vermeiden - das ist das wichtige Ziel dieser Handlungshilfe. Der Leitfaden enthält kurz und prägnant die wichtigsten Sicherheitsregeln zum Vermeiden von Gefahren bei Fischerei-typischen Arbeitsvorgängen. Eine jederzeit ausreichende Stabilität von Fischkuttern, die eindeutige Kommunikation bei Hebevorgängen und Vorsichtsmaßnahmen beim Betreten gefährlicher Räume und Arbeiten mit gefährlichen Werkstoffen – das Thema Sicherheit ist auch in der Fischerei vielseitig.
Den Autoren der Broschüre, allen voran Johann Poppinga, zuständige Aufsichtsperson der BG Verkehr für die Fischerei, ist besonders der hohe Praxisbezug wichtig. Dazu gehören auch konkrete Beispiele für Situationen, in denen Fischer unbedingt ihre Persönliche Schutzausrüstung tragen sollten und was in einem Seenotfall zu tun ist.
Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr können die Broschüre auch kostenlos in Papierform bei der BG Verkehr unter https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/broschueren/sicheres-arbeiten-in-der-fischerei bestellen.
Die BG Verkehr, das BSH und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) haben ein Rundschreiben zum Schutz vor Cyber-Risiken in der Seeschifffahrt herausgegeben. Die praktische Arbeitshilfe mit dem Titel "ISM Cyber Security" enthält Empfehlungen für IT-Schutzmaßnahmen im Land- und Seebetrieb. Reedereien können sich so im Rahmen ihres ISM-Systems besser vor Cyber-Risiken schützen.
Auch für die Seeschifffahrt als wichtiger Teil der Logistikkette wird das Thema Cyber-Sicherheit immer wichtiger. Spätestens der Angriff mit der Schadsoftware "NotPetya" im Jahr 2017, bei dem allein bei der Maersk-Reederei ein Schaden von mehreren hundert Millionen Euro entstand, hat deutlich gemacht, welche immensen Ausmaße Cyber-Angriffe in der Seeschifffahrt haben können.
Mit der Resolution MSC.428(98) fordert die IMO Reedereien auf, sich ab 2021 vor Cyber-Risiken zu schützen. Die Schiffsbetreiber sollen entsprechende Maßnahmen in ihre bestehenden ISM-Systeme integrieren.
Das neue Rundschreiben "ISM Cyber Security" von BG Verkehr, BSH und BSI gibt einen Überblick über das Thema Cyber-Sicherheit in der Seeschifffahrt und hilft Reedereien, ein ganzheitliches Cyberrisiko-Management zu entwickeln. Als Mindestabsicherung empfehlen die drei Behörden die sogenannten IT-Grundschutzprofile des BSI zum Landbetrieb und zum Schiffsbetrieb. Diese Muster-Sicherheitskonzepte enthalten konkrete Empfehlungen für IT-Sicherheitsmaßnahmen an Bord und an Land.
In einem neuen Video erklärt der Seeärztliche Dienst der BG Verkehr das richtige An- und Ablegen der persönlichen Schutzausrüstung . Die für die Medizin an Bord zuständigen Nautischen Offiziere können sich so effektiv gegen Infektionskrankheiten schützen. Das Video ist ab sofort abrufbar.
Wie schützt man sich an Bord, wenn der Verdacht auf eine Infektionskrankheit bei einer Person an Bord besteht? Diese Frage ist in der Seefahrt nicht neu, aber durch die Covid-19-Pandemie wieder in das Bewusstsein der Seeleute gerückt. Das im Herbst neu erschienene Medizinische Handbuch See des Seeärztlichen Dienstes gibt dazu konkrete Antworten und wird jetzt durch ein neues Video erweitert.


Der beste Schutz gegen ansteckende Infektionen an Bord ist regelmäßiges Händewaschen, Desinfizieren und Tragen der der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mund-Nasen-Maske und Schutzbrille. Die beste Schutzausrüstung hilft aber nur, wenn Seeleute sie richtig an- und ablegen. Dabei hilft das neue Video des Seeärztlichen Dienstes "An- und Ablegen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA)". Der gut dreiminütige Lehrfilm erklärt unter anderem, in welcher Reihenfolge die Schutzausrüstung abgelegt werden muss, damit es zu keinen ungewollten Infektionen kommt.
Seeleute können sich das Video auf Deutsch und Englisch über einen QR-Code oder über den Link https://www.medizinisches-handbuch-see.de/Schutzausruestung.html abrufen. Der Film ist Bestandteil des Medizinischen Handbuches See, das die zentrale Praxishilfe zur medizinischen Versorgung an Bord von Seeschiffen ist.

Da das Video nach dem Erscheinen der deutschen Ausgabe des Medizinischen Handbuches See konzipiert wurde, fehlt dort der QR-Code. Die Nutzer des Handbuches sollten den QR-Code auf den Seiten 26 und 485 einkleben. In der englischen Ausgabe des Handbuches, das in Kürze erscheint, ist der neue QR-Code schon enthalten.
Lange galt Asbest als Wundermittel: Das natürliche Mineral ist feuerfest, isolierend, leicht zu verarbeiten und zudem noch günstig. Doch Asbest macht krank und kann Krebs verursachen. Die BG Verkehr hat nun zusammengefasst, was Reedereien bei einer Einflaggung eines asbestbelasteten Schiffes beachten müssen.
Wer in der Vergangenheit mit Asbest arbeitete, atmete häufig den Staub und damit die feinen Asbestfasern ein. Die mögliche Folge: bösartige Krebstumore oder Veränderungen des Lungenfells. Die Berufsgenossenschaften erkennen die berufsbedingte Staublungenerkrankung durch Asbest, die sogenannte Asbestose, als Berufskrankheit an. Asbest ist bei den tödlich verlaufenden Berufskrankheiten die häufigste Todesursache. Zwischen der Arbeit mit Asbest und dem Ausbruch der Krankheit können mehrere Jahrzehnte liegen. Im Mittel liegt die Latenzzeit bei 38 Jahren.
Seit 1993 darf Asbest in Deutschland nicht mehr hergestellt oder verwendet werden, auf europäischer Ebene seit 2005. Ab 2019 müssen alle Schiffe unter einer EU-Flagge ab 500 BRZ über ein Gefahrstoffverzeichnis verfügen, in dem auch Asbest erfasst sein muss. Mit dieser Verpflichtung aus der Verordnung EU/1257/2013 will die EU die Vorgaben aus der Schiffsrecyling-Konvention („Hong Kong Convention“) in ihr Recht umsetzen.
Weltweit gibt es dagegen kein Asbest-Verbot. Auf älteren Seeschiffen kann daher noch Asbest vorhanden sein. Flaggt ein solches Schiff unter die deutsche Flagge ein, muss der Reeder unter anderem eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, ein Asbest-Kastaster erstellen und für Pflicht-Vorsorgeuntersuchungen für seine Seeleute sorgen. Der Geschäftsbereich Prävention der BG Verkehr hat eine „Zusammenstellung der Pflichten eines Reeders bei der Einflaggung eines asbestbelasteten Schiffes“ erstellt.
Ergänzend zu dieser Zusammenstellung müssen Schiffsbetreiber auch die Vorschriften des internationalen SOLAS-Übereinkommens zum Verbot von Asbest auf Seeschiffen beachten. Das Rundschreiben MSC.1/Circ1374 "Informationen zum Verbot der Verwendung von Asbest an Bord von Schiffen" des Schiffssicherheitsausschusses der IMO gibt genauere Vorgaben und Informationen zum Thema Asbest auf Seeschiffen:
- Auf Schiffen, welche vor dem 01.07.2002 gebaut wurden, dürfen asbesthaltige Materialien noch verbaut und zugelassen sein, sofern von diesen Materialien keine Gefährdung für die Besatzung an Bord ausgeht.
- Auf Schiffen, welche nach dem 01.07.2002 und vor dem 01.01.2011 gebaut wurden, darf der Einbau von asbesthaltige Materialien noch in Ausnahmefällen genehmigt worden sein.
- Auf Schiffen, welche nach dem 01.01.2011 gebaut wurden, dürfen asbesthaltige Materialien nicht mehr verbaut und neu eingebaut werden (vgl. Kapitel II-1, Regel 3-5 des SOLAS-Übereinkommens).
Das Rundschreiben ist im Verkehrsblatt Heft 19/2013 vom 23.09.2013 in deutscher Sprache veröffentlicht worden und ist für Schiffe unter deutscher Flagge verbindlich.
Auf manchen Seeschiffen finden Fachleute bei späteren Untersuchungen Asbest - zum Beispiel beim Erstellen eines Gefahrstoffinventars (IHM) nach der der EU-Verordnung 1257/2013 und des Hongkong-Übereinkommens für das Recycling von Schiffen. In diesen Fällen gilt für eine Asbestsanierung an Bord oder den Austausch des gesamten asbesthaltigen Materials eine Übergangszeit von maximal drei Jahren (vgl. Rundschreiben MSC.1/Circ1374). Diese Übergangszeit von maximal drei Jahren kann auch dann nicht verlängert werden, wenn:
- das Schiff zwischenzeitlich seine Flagge wechselt oder
- bei einem Schiff unter ausländischer Flagge bereits vor drei Jahren Asbest festgestellt wurde und das Schiff jetzt unter die deutsche Flagge gebracht werden soll.
Für Rückfragen zu diesen Vorgaben stehen die Experten der Abteilung Maschine der Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr gerne bereit (e-mail: maschine@bg-verkehr.de oder Dipl.-Ing. Holger Steinbock unter der Tel.: +49 40 361 37-217).
Kontrollkrängungsversuche bei Fischereifahrzeugen unter 24m Länge müssen unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr nach 10 Jahren durchgeführt werden. Das Bundesverkehrsministerium hat die Schiffssicherheitsverordnung vor kurzem geändert. Für Fischer bedeutet das eine erhebliche Erleichterung.
Bislang galt die Regel, dass die Leerschiffsdaten als Grundlage der Stabilität von Fischereifahrzeugen nach 10 Jahren durch einen Kontrollkrängungsversuch überprüft werden mussten. Auf Anregung der Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr hat das Bundesverkehrsministerium jetzt die Schiffssicherheitsverordnung geändert. Wenn ein Fischer keine Änderungen an seinem Kutter vornimmt, die Auswirkungen auf die Stabilität haben können (z. B. Einbau eines größeren Motors oder einer neuen Fischwinde o.ä.), braucht er auf Antrag zukünftig nicht mehr nach 10 Jahren einen Kontrollkrängungsversuch machen zu lassen. Faktisch ist dann ein Kontrollkrängungsversuch erst nach weiteren knapp 10 Jahren erforderlich. Die neue Vorschrift gilt für Fischereifahrzeuge bis 24 Meter Länge.
Wichtig ist, dass der Antrag spätestens 6 Monate vor Ablauf der 10-Jahres-Frist gestellt wird. Der Antrag ist hier herunterzuladen oder auf der Website in der Rubrik "Schiffsarten/Fischereifahrzeuge" zu finden.
Egal, ob mit oder ohne Antrag: Fischer müssen weiterhin immer dann sofort die Dienststelle Schiffssicherheit informieren, wenn sie ihren Kutter umgebaut oder andere stabilitätsrelevante Veränderungen vorgenommen haben. Diese Verpflichtung dient vor allem der eigenen Sicherheit der Fischer.

Bei starkem Seegang kann der Aufenthalt auf der Kommandobrücke lebensgefährlich sein. Nachdem es zu sehr schweren Unfällen kam, entwickelten BG Verkehr und Hapag-Lloyd ein Haltesystem für die Brückenbesatzung.
Seeschiffe sind bei Wind und Wetter weltweit im Einsatz. Dabei werden auch Seegebiete befahren, in denen Wirbelstürme und andere extreme Wetterlagen auftreten können. Normalerweise stellt das für die Schifffahrt in Bezug auf die Sicherheit der Besatzung ein beherrschbares Problem dar.
Treffen jedoch ungünstige Umstände zusammen, kann es im Einzelfall zu nicht vorhersehbaren, äußerst heftigen Bewegungen um die Längsachse des Schiffes kommen. Das Schiff beginnt, immer stärker zu „rollen“, während sich die Längsachse unterhalb der Wasserlinie am Gewichtsschwerpunkt befindet. Begünstigt wird diese heftige Bewegung zum Beispiel durch bestimmte Formen des Unterwasserschiffes, des Beladungszustandes (und damit der Stabilität) des Schiffes und die besonderen Bedingungen in dem Seeraum, der zum Manövrieren zur Verfügung steht.
Die Kommandobrücken großer Containerschiffe befinden sich 40 bis 50 Meter über der Drehachse, sodass Personen hier neben der horizontalen Bewegung des Untergrundes auch erheblichen horizontalen und vertikalen Beschleunigungskräften ausgesetzt sind. Verliert eine Person in einer solchen Situation den Halt und kommt ins Rutschen, dann sind in der Regel aufgrund der Winkel und Rutschstrecken schwere Verletzungen unvermeidbar.

Gemeinsam mit der Reederei Hapaq Lloyd hat sich die BG Verkehr deshalb auf die Suche gemacht nach einem praktikablen Sicherheitssystem für die Brücke. Dabei wurden unter Einbezug von Experten verschiedene Ansätze verfolgt. Bewährt hat sich eine Lösung, die erstaunlich einfach zu realisieren ist: Es handelt sich um eine Kombination aus Bandschlingen und Haltegurten!
Die an verschiedenen belastbaren Stellen der Brücke verankerten Bandschlingen werden so angeordnet, dass sie einerseits möglichst kurz sind, andererseits aber eine Person ohne Unterbrechung der Sicherung zur nächsten Halteschlinge gelangen kann. Zum Einhängen in die Bandschlingen trägt die Brückenbesatzung einen Haltegurt, der mit D-Ringen zum Einhängen der Gurte und Schnellverschlüssen versehen ist. Die Gurte können zwar einen Sturz nicht vollständig verhindern, aber danach halten sie die Person sicher fest. So wird verhindert, dass jemand meterweit herumgeschleudert wird und sich dabei schwerste Knochenbrüche zuzieht.
Die Erprobungen an Bord von Containerschiffen der Hapag-Lloyd verliefen erfolgreich: Das System lässt sich einfach und mit geringen Kosten realisieren und wird von den Besatzungen durchweg positiv beurteilt. Christian Naegeli, Sicherheitsfachkraft bei Hapag-Lloyd, kommentiert: „Zum Schluss waren wir alle überrascht davon, wie einfach und effizient sich das Risiko reduzieren lässt. Die Brückenbesatzungen schätzen die neue Sicherung, denn man kann die Gurte schnell und einfach anlegen. Der Bewegungsspielraum bleibt erhalten.“
Hapag-Lloyd hat mittlerweile die komplette Flotte mit dem Sicherungssystem ausgestattet. Ergänzt wird diese Lösung noch durch die Anbringung einer ausreichenden Anzahl belastbarer Haltegriffe auf der Brücke. Der Rudergänger wird zusätzlich durch eine Art Käfig gesichert, der eine zuverlässige Sicherung ohne weitere Maßnahmen gestattet. Diese technischen Lösungen zeigen anschaulich, wie Führungsverantwortliche lebensgefährliche Unfallsituationen wirksam entschärfen können – ganz im Sinne der Präventionskampagne Vision Zero.

Wegen der Corona-Pandemie verlegt die BG Verkehr ihre ursprünglich für den 12. Mai geplante Branchenkonferenz zum Thema Asbest an Bord von Seeschiffen auf den 27. August 2020. Auf der Veranstaltung werden Expertinnen und Experten Hintergrundinformationen geben und Handlungsmöglichkeiten für betroffene Reedereien aufzeigen.

Asbest und asbesthaltige Materialien dürfen seit 1990 auf Schiffen unter deutscher Flagge und seit 2011 weltweit in der Schifffahrt nicht mehr verwendet werden. Dennoch kommt es immer wieder zu Funden asbesthaltiger Materialien an Bord von Schiffen. Das gilt für Schiffe, für die eine Asbestfreiheitsbescheinigung der Werft vorliegt, und sogar für Schiffe jüngeren Baudatums.
Asbesthaltige Materialien wurden auf Schiffen vorwiegend als Brand- und Hitzeschutzisolierungen sowie als Dichtungsmaterial verwendet. Die krebserzeugende Wirkung inhalierter Asbestfasern auf das menschliche Lungengewebe ist erwiesen. Noch heute sterben mehr Versicherte der gesetzlichen Unfallversicherung an den Spätfolgen von Asbest als an Arbeitsunfällen.
Was also tun, wenn an Bord Asbest gefunden wird? Die BG Verkehr möchte mit einer Branchenkonferenz am 27. August in Hamburg die Suche nach Antworten vorantreiben. Es soll Transparenz geschaffen werden, wo und in welchem Umfang mit asbesthaltigen Materialien zu rechnen ist, und welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Gefährdung von Besatzungen und Dritten durch eine Asbestexposition zu vermeiden.
Weitere Informationen zur Branchenkonferenz finden Sie auf der Homepage der BG Verkehr. Dort ist auch die Anmeldung möglich. Zusätzlich finden Sie in einer früheren Nachricht über das Thema "Umgang mit Asbest an Bord von Seeschiffen" bereits wichtige Informationen.
Ab sofort können sich unabhängige Sachverständige für die Bewertung historischer Wasserfahrzeuge (Traditionsschiffe) bei der Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr bewerben. Die Sachverständigen müssen Geschichte studiert und in der Schifffahrtsgeschichte geforscht oder gleichwertige Spezialkenntnisse haben.
Nach der Schiffssicherheitsverordnung (SchSV) müssen Betreiber von Traditionsschiffen Angaben zur Geschichte ihres Schiffes mit beweiskräftigen Belegen für die Authentizität und Identität des Schiffes z. B. in Form von Fotografien oder Zeichnungen vorlegen. Reichen diese Unterlagen nicht aus oder handelt es sich bei dem Schiff um einen Rückbau oder Nachbau, muss der Schiffsbetreiber ein Gutachten eines von der BG Verkehr anerkannten Sachverständigen zum Nachweis der Voraussetzungen für eine Anerkennung als historisches Wasserfahrzeug vorlegen.

Für eine Anerkennung als Sachverständige/-r für derartige Gutachten müssen Interessenten einen schriftlichen Antrag bei der BG Verkehr stellen. Die Bewerber müssen persönlich und fachlich geeignet sein und die Gewähr bieten, ihre Gutachtertätigkeit als Sachverständiger unabhängig auszuüben.
Fachlich müssen die Antragsteller:
- über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Geschichtswissenschaften, vorzugsweise mit dem Schwerpunkt Technikgeschichte, und Forschungserfahrung in der deutschen und europäischen Schifffahrtsgeschichte verfügen, oder
- in gleichwertiger Weise vertiefte, in qualifizierten Lehrgängen oder auf andere Weise erworbene Spezialkenntnisse und Erfahrungen nachweisen und
- über die für die Aufgabenwahrnehmung notwendigen Rechts- und Verwaltungskenntnisse verfügen.
Die Einzelheiten zu einer Anerkennung eines Schiffes als Traditionsschiff, insbesondere, wann es sich um einen Rückbau oder Nachbau handelt, können Sie auf unserer Website im Bereich Traditionsschiffe nachlesen.
Einzelheiten des Anerkennungsverfahrens als Sachverständige/-r entnehmen Sie bitte der Verfahrensordnung zur Anerkennung von Sachverständigen.
Von der BG Verkehr anerkannte Sachverständige werden bei Bedarf im Auftrag des Betreibers tätig, der auch die Kosten für ein Gutachten trägt.
Bei Interesse an einer Tätigkeit als Sachverständige/-r im Bereich Traditionsschifffahrt wenden Sie sich bitte an:
Oya Sönmez
Tel. 040/361 37-239
E-Mail: oya.soenmez@bg-verkehr.de
oder
Sara Vatankhah
Tel.: 040/361 37-200
E-Mail: sara.vatankhah@bg-verkehr.de
Fünf Jahre nach Inkrafttreten der Maritimen-Medizin-Verordnung (MariMedV) zieht die Bundesregierung eine positive Bilanz. In einem Bericht an den Bundesrat beschreibt sie in einem ausführlichen Bericht, wie sich die Änderungen in der Praxis bewährt haben.
Vor fünf Jahren löste die MariMedV die bis dahin geltende Krankenfürsorgeverordnung ab. Zusammen mit dem Seearbeitsgesetz änderten sich viele Vorgaben, unter anderem:
- der Wechsel der Landes- zur Bundeszuständigkeit für die Zulassung und Überwachung medizinischer Wiederholungslehrgänge für Schiffsoffiziere und Kapitäne,
- die vereinfachte Beschaffung von Arzneimitteln für Seeleute auf Schiffen im Ausland,
- die Zulassung von Schiffsärzten auf Schiffen unter deutscher Flagge sowie
- die Zentralisierung der seearbeitsrechtlichen Überwachungs- und Vollzugsaufgaben bei der BG Verkehr.
Der Bundesrat forderte die Bundesregierung damals auf, fünf Jahre nach Inkrafttreten der MariMedV einen Erfahrungsbericht über die Auswirkungen der neuen Regelungen vorzulegen. Dieser Bericht liegt nun als Bundesrats-Drucksache 548/19 vor.
In dem 14 Seiten umfassenden Bericht nimmt die Bundesregierung ausführlich Stellung zu den seinerzeit beschlossenen Änderungen. Das Fazit: Die MariMedV hat sich in der Praxis bewährt.
Durch die MariMedV änderte sich seinerzeit die Zuständigkeit für die Zulassung medizinischer Wiederholungslehrgänge für Schiffsoffiziere. Waren zuvor die Länder dafür verantwortlich, brauchen sich die Kursanbieter seit 2014 nur noch an eine Stelle wenden - den Seeärztlichen Dienst der BG Verkehr. Die Bundesregierung stellt fest, dass das Zulassungsverfahren seitdem transparenter geworden ist und große Zustimmung bei den Lehrgangsanbietern findet.

Die Überwachung der Anbieter von medizinischen Wiederholungslehrgängen wurde ebenfalls von den Ländern auf die BG Verkehr übertragen. Auch diese Änderung bewertet die Bundesregierung positiv: "Die Effektivität der Überwachung der Lehrgangsanbieter sowie die Effektivität der Maßnahmen zur Qualitätssicherung durch die BG Verkehr sind durch die guten bis sehr guten Ergebnisse der kontinuierlichen Evaluation nachgewiesen. Die durchgängig guten Ergebnisse aller Lehrgänge zeigen, dass die vom Verordnungsgeber vorgesehene Standardisierung des Überwachungsverfahrens richtig war."
Durch das 2013 in Kraft getretene Seearbeitsgesetz hat der Gesetzgeber die Zuständigkeit für das Seearbeitsrecht bei der BG Verkehr zentralisiert. Die Überprüfung der medizinischen Ausstattung an Bord von Handelsschiffen unter deutscher Flagge ist seitdem Teil der seearbeitsrechtlichen Flaggenstaatkontrolle und liegt nicht mehr bei den Hafenärztlichen Diensten. Nach Auffassung der Bundesregierung ist der Vorteil dieses Verfahrens, dass eine verantwortliche Stelle die Schiffe sowohl überprüft als auch die Beseitigung möglicher festgestellter Mängel überwacht.
Seit 2014 sind die Reeder zudem gesetzlich verpflichtet, sich bei der Beschaffung von Arzneimitteln - auch im Ausland - der Hilfe einer mitwirkenden Apotheke zu bedienen. Damit müssen im Ausland gekaufte Arzneimittel nicht mehr wie früher nach dem Anlaufen des ersten deutschen Hafens durch deutsche Medikamente ersetzt werden.
Die Bundesregierung betont, dass diese Regelung zu einer Entbürokratisierung und Kostenentlastung für die Reeder gesorgt hat, zugleich aber eine gleichbleibend hohe Arzneimittelqualität an Bord gewährleistet ist.
Ein medizinischer Notfall auf See - kein Rettungsdienst, kein Krankenhaus, keine Ärzte. Kapitäne und nautische Offiziere sind dann in der Pflicht zu helfen. Mit dem Handbuch kann die medizinische Versorgung an Orten, fernab jeder medizinischen Infrastruktur, bestmöglich unterstützend sichergestellt werden.
Dieses Buch von Praktikern für Praktiker bietet kompakte Behandlungsempfehlungen für Notfälle, Verletzungen und Krankheiten an Bord von Seeschiffen. Anschauliche, leicht verständliche,"seetaugliche" Texte und 350 Abbildungen unterstützen bei der richtigen medizinischen Versorgung.
Als besonderen Service können über QR Codes Lehrfilme abgerufen werden, die Schritt für Schritt komplexe Behandlungsmaßnahmen darstellen.
Das Medizinsiche Handbuch See ist jetzt auch auf Englisch mit dem Titel "Maritime Medical Handbook" erschienen.
Erhältlich ist das Medizinische Handbuch See beim
Dingwort Verlag in Hamburg.
Außerdem kann es online https://dingwort-verlag.de/medizin/ bestellt werden.
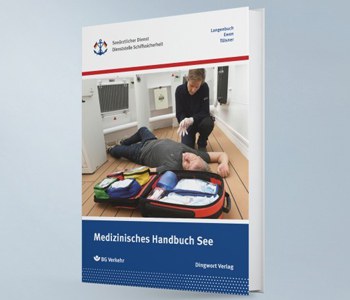
Sie sind der Hingucker in den Häfen und Küstengewässern: Traditionsschiffe. Gerade bei maritimen Großereignissen wie der Kieler Woche oder der Hansesail wollen viele Gäste das besondere Flair an Bord der Oldtimer-Schiffe genießen und buchen eine Fahrt. Manche Betreibervereine beklagen aber in letzter Zeit, die Vorgaben der Behörden für solche Gästefahrten seien zu hoch - stimmt das?
Als Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr sind wir für die Genehmigung dieser Gästefahrten verantwortlich. Uns ist wichtig zu erklären, warum und unter welchen Vorgaben wir Gästefahrten auf Traditionsschiffen zulassen - und wann nicht.
Die Kritik von Traditionschiffs-Betreibern zielt vor allem auf zwei Punkte ab:
- die Auflagen für Gästefahrten bei maritimen Großereignissen,
- Nachtfahrten nur mit einer begrenzten Personenzahl an Bord.

1. Auflagen für Gästefahrten bei maritimen Großereignissen
Gästefahrten zu maritimen Großereignissen wie dem Hamburger Hafengeburtstag, der Kieler Woche oder der Hansesail sind für viele Betreibervereine eine wichtige Einnahmequelle für den Erhalt ihrer Traditionsschiffe. Bei solchen Veranstaltungen sind dann deutlich mehr Fahrgäste an Bord als üblich.
Seit langem genehmigen wir solche Fahrten - und wollen das auch in Zukunft weiter tun. Unsere Aufgabe ist es dabei, auf die Schiffssicherheit zu achten. Gäste, die eine Mitfahrt auf einem Traditionsschiff buchen, erwarten zu Recht, dass sie sicher transportiert werden. Dafür prüfen wir, ob die Schiffsbetreiber verschiedene Vorgaben einhalten. Fahrten mit vielen Gästen an Bord dürfen nur tagsüber (siehe Punkt 2) bei einer festgelegten maximalen Wind- und Seegangsstärke und einer bestimmten Distanz bis zur Küstenlinie oder einem sicheren Hafen durchgeführt werden. Für jede Person an Bord muss mindestens eine Decksfläche auf den Außendecks von 0,7qm vorhanden sein. Außerdem muss jede Person unter Deck oder in den Deckshäusern sitzen können und zwei Fluchtwege haben. Neben einem geprüften Evakuierungsplan muss jeder Schiffsbetreiber mit einer praktischen Sicherheitsübung nachweisen, dass die Fahrgäste und Besatzungsmitglieder sicher von Bord evakuieren werden können. Natürlich müssen ausreichend Rettungsmittel an Bord sein.
Werden alle Auflagen erfüllt, erhält der Schiffsbetreiber von uns ein Sicherheitszeugnis und darf mit mehr Gästen als üblich Tagesfahrten durchführen. Eine Sondergenehmigung für jedes maritime Großereignis ist nicht erforderlich.
2. Nachtfahrten nur mit einer begrenzten Personenzahl an Bord
Traditionsschiffe dürfen auch nachts mit Gästen an Bord fahren. Allerdings ist die Zahl der Personen an Bord begrenzt und deutlich kleiner als bei den Tagfahrten zum Beispiel zu maritimen Großveranstaltungen. Wir halten diese Beschränkung aus Sicherheitsgründen für erforderlich, da Traditionsschiffe aufgrund ihrer Konstruktion, ihres Alters und der Bauweise in der Regel nicht die heutigen Sicherheitsstandards für Fahrgastschiffe erfüllen können und zudem für Schiffsführer von Traditionsschiffen keine Berufspatente vorgeschrieben sind.
Gerade bei maritimen Großereignissen sind Nachtfahrten auf engen Revieren mit vielen anderen Schiffen und der Hintergrundbeleuchtung einer Großstadt sehr anspruchsvoll und erfordern viel navigatorisches Können und langjährige Praxis, wie sie für Berufspatente vorgeschrieben sind. Die Anforderungen an solche Nachtfahrten mit vielen Personen an Bord sind so hoch, dass sie von den überwiegend ehrenamtlichen Crews, die nur gelegentlich auf Traditionsschiffen fahren, nicht verlangt werden können.
Wir schreiben die zugelassene Personenzahl für Tages- und für Mehrtagesfahrten in die Sicherheitszeugnisse für Traditionsschiffe, so dass die Betreibervereine genau planen können, wie viele Gästebuchungen sie annehmen können.
Bei der chemischen Ballastwasser-Behandlung werden häufig Nebenprodukte freigesetzt. Mit geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Besatzung können die Risiken beim Begehen der Ballastwassertanks minimiert werden. Die Präventionsabteilung der BG Verkehr berät dazu Reedereien mit deutschflaggigen Schiffen.
Der richtige Umgang mit Ballastwasser ist in den letzten Jahren spätestens seit dem Inkrafttreten des internationalen Ballastwasser-Übereinkommens ein wichtiges Thema geworden. Dabei geht es vor allem darum, das Einschleppen gebietsfremder Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen zu verhindern. Die Reedereien stehen vor der Herausforderung, wie Ballastwasser in der täglichen Praxis entsorgt oder aufbereitet werden soll.
Die Aufbereitung von Ballastwasser geschieht mit einem bordseitigen Ballastwasser-Behandlungssystem. Mit welchem Verfahren das Wasser gefiltert und aufbereitet wird, hängt von der gewählten Anlage ab. Je nach Fahrtgebiet der Schiffe, bestehender Wassertemperatur, Volumenstrom in der Hauptballastwasserleitung und Haltezeit in den Tanks kommen unterschiedliche Methoden infrage. Welche Anlage an Bord installiert wird, entscheidet letzten Endes die Reederei.
Unter den zugelassenen Systemen gibt es Anlagen, die zur Aufbereitung des Ballastwassers sogenannte „aktive Substanzen“ (zum Beispiel freies Chlor, Brom oder Ozon) verwenden. Bei dieser chemischen Behandlung bilden sich Desinfektionsnebenprodukte. So können zum Beispiel bei der Verwendung von Chlor als aktive Substanz verschiedene Trihalogenmethane, wie Chloroform, entstehen.
Welche Desinfektionsnebenprodukte in welchem Umfang bei der Ballastwasserbehandlung entstehen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem können organische Einträge (zum Beispiel durch ungeklärte Abwässer) im Fluss- bzw. Meerwasser, das als Ballastwasser aufgenommen und behandelt wird, einen Einfluss auf die Entstehung von Desinfektionsnebenprodukten haben. Im Klartext: Je schmutziger das aufgenommene Ballastwasser, desto höher der Desinfektionsaufwand und desto mehr Desinfektionsnebenprodukte können entstehen.

Dabei kommt die Frage auf, inwiefern diese Substanzen zur Belastung werden können für Schiffsbesatzungen oder andere Versicherte, wie Besichtiger, die an Bord von Seeschiffen tätig werden. Welche Maßnahmen müssen getroffen werden, wenn beispielsweise die Begehung eines Ballastwassertanks zu Inspektionszwecken ansteht?
Ballastwassertanks sind gefährliche Räume im Sinne des Arbeitsschutzes. Denn auch ohne die Behandlung von Ballastwasser kann es zum Beispiel durch die Anwesenheit bestimmter Mikroorganismen zu einer Anreicherung von Gasen kommen, die einen gefährlichen Einfluss auf die Atmosphäre im Tank haben. Insofern müssen Ballastwassertanks grundsätzlich als gefährliche Räume betrachtet werden.
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung werden dementsprechend geeignete Maßnahmen festgelegt, um die Gefährdungen durch eine belastete Atmosphäre in den Ballastwassertanks zu minimieren. Dazu einige Beispiele:
- Ausreichende Ventilation mithilfe aktiv angetriebener Lüfter vor und während der Tankbegehung sicherstellen.
- Zusätzlicher Wechsel des Ballastwassers während der Reise. Unbelastetes Meerwasser auf hoher See an Bord zu nehmen, kann die Entstehung von Desinfektionsnebenprodukten vor einer Tankbegehung auf ein Minimum reduzieren.
- Grundsätzlich hat es sich bewährt, kurzfristig vor einer Begehung einen nahezu vollen Tank leer zu pumpen, da die Tankatmosphäre vor der Begehung dabei mit „frischer“ Luft befüllt wird.
- In jedem Fall muss vor dem Einstieg eine Befahrerlaubnis erstellt werden.
Bei Fragen zur Gefährdungsbeurteilung bei Inspektionen von Ballastwassertanks stehen die Aufsichtspersonen der BG Verkehr, Branche Seeschifffahrt und Fischerei, für Reedereien mit Schiffen unter deutscher Flagge gerne zur Verfügung. Die Aufsichtspersonen kennen den Bordbetrieb aus ihrer aktiven Seefahrtzeit. Mit dieser Erfahrung und den Kenntnissen im Vorschriften- und Regelwerk überwachen und beraten sie die Betriebe der Branche zum Arbeits- und Gesundheitsschutz an Bord von Seeschiffen.
Mehr Informationen zur Ballastwasserbehandlung finden Sie in unserer Rubrik „Umweltschutz‟ (sowie in den FAQ zu finden). Dieses Thema und andere interessante Informationen zum Thema Unfallsicherheit an Bord finden Sie im "SicherheitsProfi" 3/2019 der BG Verkehr (Branchenausgabe Schifffahrt).
Der überarbeitete Lebensmittelhygiene-Leitfaden gibt praxisnahe Anleitungen und hilfreiche Verfahren für einen hygienischen und sicheren Umgang mit Lebensmitteln an Bord von Schiffen.
Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist wichtig, besonders wenn man hart arbeitet. An Bord eines wochenlang fahrenden Schiffs muss vorausschauend geplant werden und die Nahrungsmittel richtig gelagert und zubereitet werden, damit das Essen auf dem Teller gut schmeckt und auch gesund und bekömmlich ist.
Im überarbeiteten Lebensmittelhygiene-Leitfaden der Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr wird praxisnah erklärt was alles zu einer hygienischen Lebensmittelversorgung an Bord gehört. Was der Reeder, der Kapitän und das Küchen- und Bedienpersonal tun können und müssen, damit bei der Lebensmittellagerung und -zubereitung keine Gefahren und Gesundheitsrisiken entstehen, wird übersichtlich dargestellt. Dabei sind sauberes Trinkwasser, die richtige Lagerung unterschiedlicher Lebensmittelsorten und die hygienische Zubereitung Schwerpunkte des Leitfadens.
Anschaulich stellen die neuen Bilder und Grafiken dar wie es richtig geht und was zu vermeiden ist. In den hinzugekommenen Anlagen wird gezeigt wie man sich richtig die Hände wäscht und wie der Arbeitsplatz Küche nicht nur sauber, sondern auch sicher gehalten wird. Anhand einer neuen Checkliste kann die sichere Lebensmittellagerung und -verarbeitung regelmäßig und selbstständig überprüft werden.

Eine überzeugende Sicherheitskultur an Bord zu etablieren, kann nur gelingen, wenn alle Besatzungsmitglieder an ihr aktiv beteiligt sind. Gefahren lauern immer da, wo Sicherheitsvorschriften nur halbherzig beachtet werden. Mit ihren neuen Sicherheits-Bulletins gibt die Dienststelle Schifssicherheit der BG Verkehr praktische Tipps für eine gute Sicherheitskultur an Bord.
Den Auftakt der neuen Sicherheits-Bulletins macht das Thema Gefährliche Räume. Zu Anfang zeigt ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag an Bord, wann und wo es zu Gefährdungen kommen kann. Denn gerade, wenn etwas tagtäglich gemacht wird, schleicht sich leicht eine Unachtsamkeit ein. Außerdem weisen die Beispiele anhand realer Vorkommnisse auf eventuell vorhandene Schwachpunkte in den Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen bei bestimmten Betriebsabläufen hin.
Die Sicherheitshinweise erscheinen in Bulletinform, weil eine überzeugende und erfolgreiche Sicherheitskultur ein fortwährender Prozess ist. Die Bulletins sollen anregen, die bestehenden Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen an Bord immer wieder gemeinsam zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Das heißt die Besatzung und die Reederei müssen zusammenarbeiten, damit die Sicherheitsmaßnahmen für den Betriebsalltag tauglich sind und gleichzeitig die Rechts- und Unternehmens-Vorgaben erfüllen. Dort wo sich eine Sicherheitsmaßnahme nicht bewährt, muss gemeinsam erarbeitet werden, wie man die Sicherheit auf eine andere Art und Weise umsetzen kann. Nur wenn alle hinter dem Schutzkonzept an Bord stehen, wird es auch konsequent umgesetzt.
Lesen Sie mehr dazu, wie Sie an Bord eine überzeugende Sicherheitskultur entwickeln können, in unserer Rubrik "Arbeitssicherheit".
Die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr hat ihre Zulassungspraxis bei Unterwasserbesichtigungen (In-Water Surveys) von deutschflaggigen Schiffen geändert. Die Kontrolle der Schiffsböden kann ab sofort auch dann im Wasser erfolgen, wenn ein Schiff kein Klasse-Zusatzzeichen für Unterwasser-Bodenbesichtigungen (z. B. "BIS", "IW") hat.
Nach dem SOLAS-Übereinkommen (Kap. I, Teil B, Regel 10a) müssen bei Seeschiffen zwei Bodenbesichtigungen innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraumes durchgeführt werden. Bei Frachtschiffen, die jünger als 15 Jahre sind, braucht jeweils die erste der beiden Besichtigungen nicht zwingend auf dem Trockenen (im Dock) absolviert zu werden, sondern kann auch im Wasser durch Taucher erfolgen.
Die Deutsche Flagge hatte bis jetzt für Unterwasser-Bodenbesichtigungen ein Klasse-Zusatzzeichen (z. B. "BIS", "IW") oder die entsprechenden baulichen Voraussetzungen dafür gefordert - unter anderem fest angebrachte Markierungen am Unterwasserschiff und für den Taucher gefahrlos zugängliche Seekästen, Ruderlager und Stopfbuchsen.
Andere Flaggenstaaten oder Klassifikationsgesellschaften orientieren sich an der derzeit gültigen IACS UR Z 3 Rev. 7 von Januar 2018 (das Kürzel "UR" steht für "Unified Requirements"). Die Dienststelle Schiffssicherheit hat ebenfalls beschlossen, für Seeschiffe unter deutscher Flagge ab sofort die Regeln der International Association of Classification Societies (IACS) zu berücksichtigen.

Unterwasser-Bodenbesichtigungen sind unter anderem unter folgenden Voraussetzungen zulässig:
- Besichtigung in geschützten Gewässern, vorzugsweise in Bereichen mit wenig Tidenströmung;
- die Sichtverhältnisse im Wasser und die Sauberkeit des Rumpfes unterhalb der Wasserlinie müssen so gut sein, dass der Besichtiger und die für die Besichtigung beauftragte Firma den Zustand der Bodenbeplattung, der Anhänge und der Schweißverbindungen sicher beurteilen können;
- die Taucherbesichtigung ist durch eine von der zuständigen Klassifikationsgesellschaft zugelassene Firma im Beisein und zur Zufriedenheit des Klassenbesichtigers durchzuführen;
- werden bei der Unterwasser-Bodenbesichtigung Schäden entdeckt, kann der Klassebesichtiger eine Bodenbesichtigung auf dem Trockenen (im Dock) anordnen.
Weitere Einzelheiten sind dargestellt in:
Auch die Seeschifffahrt muss (noch) umweltfreundlicher werden. Seit Anfang 2018 schreibt die EU den Reedern daher vor, die Emissionen ihrer Schiffe zu erfassen. Diese Vorgaben aus der sogenannten MRV-Verordnung werden jetzt durch neue Regeln der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO ergänzt. Wir erklären die Unterschiede zwischen beiden Systemen.
Seit 2018 gilt die Verordnung (EU) 2015/757 zur Überwachung von Kohlendioxidemissionen aus dem Seeverkehr. Diese Verordnung ist besser bekannt unter dem Kurz-Titel MRV, was die Abkürzung für Measuring, Reporting and Verification ist. Jetzt kommt ein neues System der IMO hinzu: das Data Collection System (kurz: DCS). In diesem Datensystem werden die Brennstoffverbräuche von Seeschiffen erfasst.
Beide Verfahren ähneln sich zwar und Reeder können einige der erhobenen Daten für beide Systeme verwenden. Es gibt aber auch Unterschiede. So überwachen zum Beispiel in Deutschland unterschiedliche Behörden die Einhaltung der Vorgaben.
Die wichtigsten Unterschiede haben wir Ihnen in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Unter der Tabelle finden Sie ausführlichere Informationen zu beiden Verfahren.
| Verfahren: | EU-MRV-Seeverkehrsverordnung | IMO DCS (Data Collection System) |
|---|---|---|
|
Überwachung von |
Kohlendioxidemissionen |
Brennstoffverbrauch |
|
Anwendung: |
Ab 5000 BRZ |
Ab 5000 BRZ |
|
Umsetzung mit: |
durch eine Prüfstelle verifiziertes Monitoringkonzept |
SEEMP (Schiffsenergieeffizienz-Managementplan) inkl. zweiter Teil, geprüft durch anerkannte Klassifikationsgesellschaft → Besichtigungsbericht oder Bestätigung der Klasse genehmigt durch Dienststelle Schiffssicherheit (bis 31.12.2018) |
|
Beginn der Datenerfassung: |
seit 1. Januar 2018 |
ab 1. Januar 2019 |
|
Datenübermittlung: |
Emissionsbericht an Deutsche Emissionshandelsstelle (beim Bundesumweltamt) bis zum 30. April des Folgejahres |
Übermittlung der Daten an Dienststelle Schiffssicherheit bis 01. April des Folgejahres |
|
Erste Übermittlung fällig am: |
30. April 2019 |
1. April 2020 |
|
Weitere Informationen: |
EU-MRV-Seeverkehrsverordnung (Kohlendioxid-Emissionen)
Die EU-MRV-Seeverkehrsverordnung ((EU) 2015/757) findet Anwendung auf Schiffen mit Bruttoraumzahl von 5.000 und mehr, die gewerbliche Fahrten von oder zu einem Hafen oder zwischen Häfen der Europäischen Gemeinschaft durchführen. Die EU-Verordnung schreibt eine Überwachung von Kohlendioxidemissionen aus dem Seeverkehr mit einem durch eine Prüfstelle verifizierten Monitoringkonzept vor.
Auf Basis der erhobenen Daten wird jährlich ein durch eine akkreditierte Prüfstelle mit einer Konformitätsbescheinigung positiv bewerteter schiffsbezogener Emissionsbericht an die Deutsche Emissionshandelsstelle bis zum 30. April des darauffolgenden Jahres übermittelt. Diese Emissionshandelsstelle ist beim Bundesumweltamt eingerichtet worden. Die Konformitätsbescheinigung ist an Bord mitzuführen.
Seit dem 1.1.2018 müssen Emissionen erfasst werden. Der erste Emissionsbericht ist am 30. April 2019 fällig.
Weitere Infos finden Sie in unserem ISM-Rundschreiben 01/2018.
IMO Data Collection System (Brennstoffverbräuche)
Die IMO hat das System zur Erfassung von Daten über den Verbrauch an ölhaltigem Brennstoff von Schiffen (DCS) für Schiffe in der internationalen Fahrt ab 5.000 BRZ beschlossen und in die Anlage VI des MARPOL-Übereinkommens aufgenommen. Für die Umsetzung wurde dem SEEMP (Schiffsenergieeffizienz-Managementplan) ein zweiter Teil hinzugefügt: Der Plan zur Erfassung der Daten über den Verbrauch an ölhaltigem Brennstoff von Schiffen.
Für Seeschiffe unter deutscher Flagge reicht der Reeder den von ihm ergänzten SEEMP Teil II an eine anerkannte Klassifikationsgesellschaft zur Prüfung ein. Die Klasse übermittelt ihren Besichtigungsbericht (Survey Report) oder ihre Anerkennungsbescheinigung (Confirmation of Compliance - Ship Fuel Oil Consumption Data Collection Plan) zur Genehmigung an die Dienststelle Schiffsicherheit der BG Verkehr, die eine entsprechende Bescheinigung für das Schiff ausstellt. Die Genehmigung durch die Dienststelle Schiffssicherheit muss bis zum 31.12.2018 erfolgen.
Die Reederei übermittelt die über das Jahr erfassten Daten an die Dienststelle Schiffssicherheit bis 1. April des Folgejahres. Die erste Übermittlung muss bis zum 1. April 2020 erfolgen.
Die jährlichen Daten über den Verbrauch an ölhaltigem Brennstoff werden von der Dienststelle Schiffssicherheit oder über die von Ihr beauftragte Klasse in die Datenbank der IMO über den Verbrauch an ölhaltigem Brennstoff von Schiffen eingetragen. Hierzu erstellt die Dienststelle Schiffssicherheit für jedes Schiff unter deutscher Flagge eine Bescheinigung (Statement of Compliance - Fuel Oil Consumption Reporting) über die ordnungsgemäße Abgabe der Jahresverbrauchsmeldung an die IMO.
Weitere Informationen und Details zu den anzugebenden Daten und verschiedenen Messmethoden finden Sie in unserem ISM-Rundschreiben 05/2018.
Aktuelle Informationen
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) stellt ab dem 01.11.2017 alle Haftungsbescheinigungen elektronisch aus und versendet sie elektronisch. Die elektronischen Haftungsbescheinigungen enthalten keine Unterschrift und kein Siegel des BSH mehr, aber neu einen QR-Code und eine Tracking Identification Number (TID).
Hier finden Sie die Muster für die elektronischen Haftungsbescheinigungen:
- Ölhaftungsbescheinigung (Öl als Bulkladung)
- Ölhaftungsbescheinigung (Bunkeröl)
- Wrackbeseitigungshaftungsbescheinigung
- Personenhaftungsbescheinigung
Antrag
Sie können ab sofort Anträge auf Ausstellung einer Haftungsbescheinigung für das kommende Versicherungsjahr (2018/2019) beim BSH stellen. Sollten Ihnen dafür aktuell noch erforderliche Unterlagen (z.B. Blue Cards) fehlen, können Sie diese gern nachreichen.
Die Antragsformulare für Haftungsbescheinigungen finden Sie unter www.deutsche-flagge.de/de/antraege-und-dokumente/antraege. Sie können nun alle Haftungsbescheinigungen per einfacher E-Mail beantragen. Originale müssen Sie nicht mehr übersenden.
Das BSH benötigt nur noch einen Antrag pro Schiff für die Ausstellung von Haftungsbescheinigungen für:
- Öl als Bulkladung (nach dem Haftungsübereinkommen von 1992),
- Bunkeröl (nach dem Bunkeröl-Übereinkommen von 2001) und
- Wrackbeseitigung (nach dem Wrackbeseitigungsübereinkommen).
Für den Antrag auf eine Personenhaftungsbescheinigung (nach der Verordnung (EG) Nr. 392/2009) verwenden Sie bitte den separaten Antrag.
Bitte beachten Sie:
- Bitte geben Sie im Antragsformular eine zentrale E-Mail-Adresse an, an die das BSH die Unterlagen versenden kann. Der Versand erfolgt aus dem No-Reply-Postfach liability@bsh.de.
- Sie müssen dem Antrag wie gewohnt die Blue Card und das ITC 69 bzw. das gültige PSSC beifügen. Wenn sich der eingetragene Eigentümer bzw. der Beförderer bei der Antragstellung durch einen Bevollmächtigten vertreten lässt, muss er eine schriftliche oder elektronische Antragsvollmacht beifügen.
- Sofern ein Zustellungsbevollmächtigter zu benennen ist (wenn das Schiff nicht die Bundesflagge führt und/oder der eingetragene Eigentümer bzw. der Beförderer keinen ständigen Wohnsitz oder Sitz in Deutschland hat), müssen Sie eine Zustellungsvollmacht („Authorisation to receive Communication“) vorlegen; eine elektronische Kopie ist ausreichend.
- Grundsätzlich wird der Gebührenbescheid an den eingetragenen Eigentümer bzw. den Beförderer erteilt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Sie einen abweichenden Gebührenschuldner benennen.
- Wenn Sie den Antrag oder die Anlagen nicht in deutscher oder englischer Sprache einreichen, müssen Sie eine Übersetzung eines behördlich anerkannten Übersetzers beifügen.
Wichtig
Bitte senden Sie die Antragsunterlagen (PDF-Dateien) per E-Mail an die E-Mail-Adresse folgender Funktionspostfächer:
- nwrc@bsh.de für Haftungsbescheinigungen (Ölhaftung, Wrackbeseitigungshaftung)
- plc@bsh.de für Personenhaftungsbescheinigungen
Bitte verwenden Sie keine personenbezogenen BSH-E-Mail-Adressen, da die Bearbeitung nur aus den oben genannten Funktionspostfächern gewährleistet wird.
Erteilung der Haftungsbescheinigungen
Sie erhalten von nun an die Haftungsbescheinigungen mit dazu gehörenden Dokumente ausschließlich per E-Mail vom BSH aus dem No-Reply-Postfach liability@bsh.de; dieser E-Mail sind folgende Dokumente angehängt:
- das Anschreiben,
- die Haftungsbescheinigung,
- der Gebührenbescheid,
- der "Information Letter", ein erläuterndes Begleitschreiben, aus dem hervorgeht, wie die Echtheit und Gültigkeit der elektronischen Bescheinigung verifiziert werden kann.
Verifizierung elektronischer Haftungsbescheinigungen
Die Verifizierung von elektronischen Haftungsbescheinigungen erfolgt bei Hafenstaatkontrollen oder anderen Überprüfungen über http://www.deutsche-flagge.de/de/zeugnisse-verifikation/e-certificates. Mit dem QR-Code erreichen Sie die Deutsche-Flagge-Website; nach Eingabe der Tracking Identification Number (TID), die Sie auf der Haftungsbescheinigung finden, öffnet sich das Dokument.
Alle vor dem 01.11.2017 in Papierform ausgestellten Haftungsbescheinigungen behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
- Frau Cordes, Tel.: +49 40-3190 7437 oder
- per E-Mail an das Funktionspostfach nwrc@bsh.de
- nur im Notfall: Maritime Hotline, Tel.: +49 40-3190 7777.
Die geplante Erhöhung des Lohnsteuereinbehaltes von 40% auf 100% für die deutsche Flagge ist Realität geworden: Ab sofort brauchen Reeder für ihre Seeleute, die auf Handelsschiffen unter deutscher Flaggen fahren, keine Lohnsteuer mehr an das Finanzamt abführen.
Grundlage für die Änderung ist das "Gesetz zur Änderung des Einkommenssteuergesetzes zur Erhöhung des Lohnsteuereinbehaltes in der Seeschifffahrt". Durch das Gesetz ist auch die bisherige 183-Tage-Regelung entfallen. Besatzungsmitglieder müssen nicht mehr in einem 183 Tage dauernden Heuerverhältnis stehen, damit ihr Reeder den Steuervorteil nutzen darf.

Die Europäische Kommission hat am 3. Mai ihre Zustimmung zu dieser Beihilfe erklärt. Mit der Veröffentlichung dieses Beschlusses im Bundesgesetzblatt ist die Neuregelung offiziell in Kraft getreten.Mit dem Gesetz lösen die Bundesregierung und die Länder ihr Versprechen ein, die deutsche Flagge wettbewerbsfähiger zu machen. Die Reeder ziehen bei ihren Seeleuten wie bisher die volle Lohnsteuer von der Heuer ab, dürfen dann aber diese Lohnsteuer für sich einbehalten. Damit werden die deutschen Reeder gegenüber vielen Schifffahrtsunternehmen im Ausland gleichgestellt, die keine Lohnsteuer für ihre Seeleute zahlen müssen.
Die Reeder dürfen den vollen Lohnsteuereinbehalt erstmals für den Lohnzahlungszeitraum Juni 2016 anwenden.
Die Gebühren der Deutschen Flagge basieren seit dem 1. Oktober auf einer neuen Rechtsgrundlage. Eine gemeinsame Gebührenverordnung für alle Bereiche der Schifffahrt und der Wasserstraßen hat die bisherigen Einzel-Verordnungen abgelöst. Die Gebühren der Deutschen Flagge bleiben weiterhin günstig. (14.12.2021)
 Die neue "BMVI-Wasserstraßen und Schifffahrt Besondere Gebührenordnung" umfasst die meisten Gebühren aus dem Bereich Schifffahrt und Wasserstraßen des Bundesverkehrsministeriums. Sie ersetzt damit auch die bisherige Gebührenverordnung der BG Verkehr. Die BSH-Gebührenverordnung bleibt dagegen vorläufig noch als Einzel-Gebührenverordnung erhalten, da deren Überarbeitung durch Änderungen am Windenergie-auf-See-Gesetzes noch etwas Zeit benötigt.
Die neue "BMVI-Wasserstraßen und Schifffahrt Besondere Gebührenordnung" umfasst die meisten Gebühren aus dem Bereich Schifffahrt und Wasserstraßen des Bundesverkehrsministeriums. Sie ersetzt damit auch die bisherige Gebührenverordnung der BG Verkehr. Die BSH-Gebührenverordnung bleibt dagegen vorläufig noch als Einzel-Gebührenverordnung erhalten, da deren Überarbeitung durch Änderungen am Windenergie-auf-See-Gesetzes noch etwas Zeit benötigt.
Die Gebühren der Deutschen Flagge sind mit der neuen Gebührenverordnung moderat angehoben worden, bleiben aber weiterhin günstig. Der Stundensatz der BG Verkehr ist um 5 Prozent von bisher 114 Euro auf künftig 119,70 Euro leicht gestiegen. Die Gebührensätze für die einzelnen Zeugnisse und Dokumente erhöhen sich im Mittel zwischen 5 und 15%.
Bei den Gebühren für Schiffsbesatzungs- und Seediensttauglichkeitszeugnisse sowie für die Reisezeiten von Besichtigerinnen und Besichtiger der BG Verkehr ändert sich nichts. Diese Reisezeiten werden fiktiv vom Ort der nächstgelegenen Außenstelle der Dienststelle Schiffssicherheit berechnet. Das war schon vorher gelebte Praxis, ist aber nun in der neuen Gebührenverordnung klar geregelt.
Mit der Neuregelung passt das Bundesverkehrsministerium die Gebühren der Dienststelle Schiffssicherheit das erste Mal seit acht Jahren an. Die nun erfolgte Erhöhung der Gebührensätze bewegt sich im Rahmen der Inflationsrate in Deutschland (seit 2013 bis heute rund 12% Steigerung).
Im internationalen Vergleich sind die Kosten für Schiffszeugnisse und andere Dokumente der Deutschen Flagge weiterhin niedriger als bei anderen Flaggen. Anders als die meisten anderen Flaggenstaaten stellt die Deutsche Flagge keine jährlichen Registrierungsgebühren in Rechnung.
Die nach wie vor günstigen Gebühren der Deutschen Flagge können Sie in unserem aktualisierten Gebühren-Rechner selbst nachvollziehen. Außerdem haben wir Ihnen die Veränderung der wichtigsten Gebühren durch die neue Gebührenverordnung in einer Gegenüberstellung zusammengestellt. Sämtliche aktuellen Gebührensätze der BG Verkehr/Dienststelle Schiffssicherheit finden Sie in Abschnitt 4 der Anlage der neuen Gebührenverordnung. Die Gebühren des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), die nicht verändert wurden, sind weiterhin in der BSH-Gebührenverordnung geregelt.
Seit dem 1. Juli gelten neue Vorgaben bei der Besetzung von Schiffen unter deutscher Flagge: Auf größeren Schiffen muss nur noch der Kapitän und ein Offizier EU-Staatsbürger sein. Außerdem entfällt die gesetzliche Vorgabe des Schiffsmechanikers.
Die Änderung ist Teil eines Maßnahmenpaketes, mit dem die Bundesregierung die Attraktivität der deutschen Flagge erhöhen will. Nachdem vor kurzem die Erhöhung des Lohnsteuereinbehaltes von 40 auf 100% in Kraft getreten ist, folgte am 1. Juli die Änderung der Schiffsbesetzungsverordnung. Neu ist die Reduzierung der Zahl der vorgeschriebenen EU-Offiziere: Waren bisher bei großen Schiffe bis zu 4 EU-Offiziere verpflichtend, müssen die deutschen Reeder auf ihren Schiffen über 8.000 BRZ nur noch einen EU-Offizier fahren. Unverändert geblieben ist dagegen die Vorgabe eines EU-Kapitäns auf allen Schiffen unter deutscher Flagge.

Ab 1. Juli ist zudem die Verpflichtung weggefallen, einen Schiffsmechaniker an Bord zu haben. Der Verband Deutscher Reeder hat sich für seine Mitgliedsunternehmen verpflichtet, die bestehenden ungekündigten, unbefristeten Arbeitsverhältnisse von Schiffsmechanikern nicht in Frage zu stellen und weiterhin Ausbildungsplätze für Schiffsmechaniker zur Verfügung zu stellen.
Die Änderungen erfolgten durch die Erste Verordnung zur Änderung der Schiffsbesetzungsverordnung, die am 17. Juni im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Nach vier Jahren soll evaluiert werden, welche Auswirkungen die Neuerung unter anderem auf das maritime know how in Deutschland hat.Die BG Verkehr stellt kurzfristig auf Antrag geänderte Schiffsbesatzungszeugnisse in elektronischer Form aus.
Schon seit Einführung der ersten europäischen Schiffsausrüstungs-Richtlinie im Jahr 1996 prüft und zertifiziert die BG Verkehr (früher: See-BG) Schiffsausrüstung nach europäischen Vorgaben. Jetzt hat die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr auch die Zulassung nach der neuen europäischen Richtlinie 2014/90/EG erhalten.
Auf vielen Ausrüstungsteilen auf Schiffen prangt es: Das Steuerrad-Symbol, das zeigt, dass es sich um geprüfte und zugelassene Schiffsausrüstung handelt. Für diese Prüfung, Konformitätsbewertung genannt, sind Zulassungsstellen verantwortlich, die wiederum von den EU-Mitgliedsstaaten benannt werden müssen.Das Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) hat jetzt der BG Verkehr die Urkunde zur Anerkennung als offizielle deutsche Stelle für die Prüfung und Zertifizierung von Schiffsausrüstungen überreicht. Damit kann die Prüf- und Zertifizierungsstelle SEE der BG Verkehr neben zwei anderen Stellen in Deutschland ihre bewährte Arbeit fortsetzen.
Mehr Informationen zur zugelassenen Schiffsausrüstung finden Sie in unserer Rubrik „Bau und Ausrüstung“.

Die deutsche Flagge ist rund um die Uhr an 365 Tagen für Sie da. Unter der Telefon-Nummer +49 40 3190-7777 erreichen Sie unsere Fachleute für alle Fragen rund um die Seeschifffahrt unter deutscher Flagge.
Die Maritime 24/7-Hotline wird vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) angeboten. Zusätzlich können Sie auch den Bereitschaftsdienst der Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr nutzen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Rubrik Ansprechpartner.

Seit Anfang Juli stellt die BG Verkehr elektronische Schiffsbesatzungszeugnisse für deutschflaggige Schiffe aus. Damit setzt die deutsche Flagge ihren Modernisierungskurs konsequent fort.
Für Schiffe in der nationalen Fahrt gibt es bereits seit Anfang 2015 E-Zeugnisse. Jetzt bietet die BG Verkehr diesen Service auch für Reedereien mit Schiffen in der internationalen Fahrt an – zunächst für Schiffsbesatzungszeugnisse, später dann auch für andere Zeugnisse.
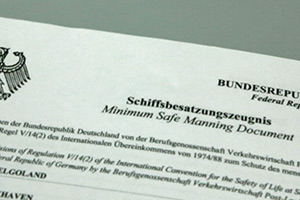
Seit Anfang Juli hat die BG Verkehr bereits über 100 Schiffsbesatzungszeugnisse ausgestellt.
Ein Klick auf "Schiffszeugnisse" und eine ID-Nummer, die von der BG Verkehr zugemailt wird, reichen aus, um das Schiffsbesatzungszeugnis in elektronischer Form abrufen zu können. Die E-Zeugnisse sind voll gültig. Neue E-Schiffsbesatzungszeugnisse können ab sofort beantragt werden.
Die deutsche Flagge hat die IMO über die neuen E-Zeugnisse informiert und ein Musterzeugnis in das IMO-Datenbanksystem GISIS eingestellt.
Der Bundestag hat am 28. Januar 2016 die Erhöhung des Lohnsteuereinbehaltes für Seeleute auf deutschflaggigen Schiffen von 40% auf 100% beschlossen. Nur einen Tag danach stimmte auch der Bundesrat der Entlastung der Reeder bei der Lohnsteuer zu.
Mit dem Gesetz wird auch die bisherige sogenannte 183-Tage-Regelung entfallen. Damit brauchen deutsche Reeder zukünftig auch für solche Seeleute keine Lohnsteuer mehr abführen, die weniger als 183 Tage beim Reeder angestellt sind. Der Wegfall dieser 183-Tage-Regelung reduziere den Verwaltungsaufwand und erhöhe die Flexibilität der Schifffahrtsunternehmen bei der Besetzung der Schiffe, so die Gesetzesbegründung (Bundestags-Drucksache 18/7268). Das Gesetz war ursprünglich vom Bundesrat eingebracht worden.
Das Gesetz wird nach der notwendigen beihilferechtlichen Zustimmung der EU-Kommission in Kraft treten und wird zunächst auf 5 Jahre befristet sein, um eine Evaluierung nach diesem Zeitraum zu ermöglichen.
Mit dem Gesetz soll das seemännische Know-how für die maritime Wirtschaft und insbesondere die Beschäftigung von Seeleuten auf Schiffen unter deutscher Flagge gesichert werden.
Die Plenardebatte im Deutschen Bundestag zu diesem Gesetz ist im Parlamentsfernsehen aufgezeichnet worden.
Der Jurist Kai Krüger (49) hat die Leitung der Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr übernommen. Er ist Nachfolger von Ulrich Schmidt, der überraschend am 22. Dezember 2016 verstarb. Krüger hatte bereits im Februar die kommissarische Leitung der Dienststelle übernommen.
Kai Krüger stammt gebürtig aus der Lüneburger Heide. Er begann seine berufliche Laufbahn in Berlin mit einer Ausbildung bei der früheren Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Anschließend war er vier Jahre bei der Bau-Berufsgenossenschaft in Hannover tätig. Nach einem Studium der Rechtswissenschaften in Hannover begann er 2003 in Hamburg als Referent bei der See-Berufsgenossenschaft. Zuletzt leitete er das Referat Recht bei der Dienststelle Schiffssicherheit.
„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Herausforderung, die Dienststelle für die Zukunft gut aufzustellen“ , beschreibt Kai Krüger seine Ziele. Kundenorientierung ist dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor. Auch die Digitalisierung bietet der Verwaltung große Chancen. „Oberstes Ziel unserer Arbeit bleibt aber die Schiffssicherheit“, so der neue Leiter der Dienststelle.
Die Dienststelle Schiffssicherheit nimmt im Auftrag des Bundes staatliche Aufgaben im Bereich der Seeschifffahrt wahr und ist Teil der deutschen Flaggenstaatverwaltung. Im Bereich der Schiffssicherheit ist die Dienststelle unter anderem für die Einhaltung der nationalen und internationalen Vorschriften zur Schiffssicherheit und zum Meeresumweltschutz sowie für die Prüfung und Zertifizierung von Rettungsmitteln und Brandschutzausrüstung zuständig. Die Besichtiger der Dienststelle führen in den deutschen Häfen die Hafenstaatkontrollen von Schiffen unter ausländischer Flagge durch. Im Bereich Seearbeitsrecht ist die Dienststelle für die Überprüfung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Seeleuten an Bord verantwortlich (Flaggenstaat- und Hafenstaatkontrolle). Mit ihrem Seeärztlichen Dienst ist die Dienststelle zudem der zentrale Ansprechpartner für alle maritim-medizinischen Fragen in Deutschland.
Die BG Verkehr bietet ein neues Seminar an, das Seeleute in der "psychologischen Erstbetreuung" schult. Das Seminar ist speziell für Situationen auf See ausgerichtet.
Ein schwerer Unfall auf Deck, ein ertrinkender Kamerad, eine Havarie, eine Seenotrettung oder gar Piraterie: Es gibt Unfälle und Tragödien an Bord, die man nicht einfach vergessen kann und die nachhaltig verstören. Solche Ereignisse überfordern oftmals die Bewältigungsmöglichkeiten der Betroffenen und können zu starken psychischen Reaktionen und Erkrankungen führen. Das kann möglicherweise vermieden werden, wenn geschulte Kollegen in diesen Situationen bei den Betroffenen eine "psychologische Erstbetreuung" leisten.

Für die Seeschifffahrt bietet die BG Verkehr deshalb ein neues Seminar an, das sich an Personen richtet, die von ihrem Betrieb im Rahmen eines Notfallmanagements als interne Ersthelfer für die kollegiale Unterstützung am Unfallort eingesetzt werden. Vergleichbare Seminare werden bereits für andere Branchen angeboten. Die Seminarinhalte sind hier auf die spezifische Situation in der Seeschifffahrt ausgerichtet. Neben Informationen zu Traumata und Folgestörungen stehen Präventions- und Rehabilitationskonzepte im Mittelpunkt.
Seminaranmeldung
Das Seminar "Umgang mit traumatisierenden Ereignissen in der Seeschifffahrt" findet vom 10. bis 12. April 2018 im niedersächsischen Amelinghausen statt. Anmeldung unter www.BG-Verkehr.de. Kontakt bei Fragen: Tel. 040 39 80 2754, E-Mail: seeschifffahrt@bg-verkehr.de.
Die deutsche Flagge ist seit dem 1. Januar noch wettbewerbsfähiger. Reeder können sich ihre gezahlten Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung voll erstatten lassen. Von dieser Förderung des Bundes profitieren vor allem Reedereien, die Schiffe unter deutscher Flagge im internationalen Seeverkehr betreiben und für ihre Seeleute Sozialversicherungsabgaben in Deutschland zahlen.
Bis zum letzten Jahr zahlte der Bund den Reedereien auf Antrag feste, pauschalisierte Zuschüsse zur Deckung ihrer Lohnnebenkosten. Seit Anfang 2017 können Seeschifffahrtsunternehmen Zuschüsse in Höhe ihrer Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für ihre europäischen Seeleute beantragen. Neu ist auch, dass Reedereien mit Schiffen unter der Flagge eines EU-/EWR-Mitgliedsstaates, die in einem deutschen Seeschiffsregister eingetragen sind, Lohnnebenkosten erstattet bekommen, wenn ihre Seeleute im Rahmen der Ausstrahlung in der deutschen Sozialversicherung versichert sind.
Reedereien können beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie einen Antrag auf Erstattung der Lohnnebenkosten für das Jahr 2017 stellen. Die genauen Förderbedingungen sind in der Richtlinie zur Senkung der Lohnnebenkosten in der Seeschifffahrt vom 28.10.2016 enthalten.
Die Erstattung der vollen Lohnnebenkosten ist der letzte Baustein eines Maßnahmenpaketes der Bundesregierung, mit der die Ausbildung und Beschäftigung am Schifffahrtsstandort Deutschland gestärkt werden soll.
Mehr Informationen finden Sie in unserer Rubrik Finanzen.
Der Bundestag hat am 28. Januar 2016 die Erhöhung des Lohnsteuereinbehaltes für Seeleute auf deutschflaggigen Schiffen von 40% auf 100% beschlossen. Nur einen Tag danach stimmte auch der Bundesrat der Entlastung der Reeder bei der Lohnsteuer zu.
Mit dem Gesetz wird auch die bisherige sogenannte 183-Tage-Regelung entfallen. Damit brauchen deutsche Reeder zukünftig auch für solche Seeleute keine Lohnsteuer mehr abführen, die weniger als 183 Tage beim Reeder angestellt sind. Der Wegfall dieser 183-Tage-Regelung reduziere den Verwaltungsaufwand und erhöhe die Flexibilität der Schifffahrtsunternehmen bei der Besetzung der Schiffe, so die Gesetzesbegründung (Bundestags-Drucksache 18/7268). Das Gesetz war ursprünglich vom Bundesrat eingebracht worden.
Das Gesetz wird nach der notwendigen beihilferechtlichen Zustimmung der EU-Kommission in Kraft treten und wird zunächst auf 5 Jahre befristet sein, um eine Evaluierung nach diesem Zeitraum zu ermöglichen.
Mit dem Gesetz soll das seemännische Know-how für die maritime Wirtschaft und insbesondere die Beschäftigung von Seeleuten auf Schiffen unter deutscher Flagge gesichert werden.
Die Plenardebatte im Deutschen Bundestag zu diesem Gesetz ist im Parlamentsfernsehen aufgezeichnet worden.
Zum Jahreswechsel wurden die Rechte von Reisenden auf See gestärkt: Der Anwendungsbereich der EU-Verordnung über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See (VO 392/2009) wurde ab dem 31.12.2018 erneut erweitert. Er erfasst nunmehr auch Schiffe in der auf 20 Seemeilen beschränkten Inlandsfahrt (Klasse B) im Sinne der EU-Fahrgastschiffsrichtlinie statt wie bisher lediglich Schiffe in der internationalen Fahrt sowie Schiffe in der unbeschränkten Inlandsfahrt (Klasse A).
Die Umsetzung der neuen DGUV Vorschrift 84 hat in der Praxis zu manchen Fragen geführt. Die BG Verkehr lud deswegen zu einer Informationsveranstaltung ein. Daraus haben wir Ihnen die Fragen und Antworten zusammengefasst.
Die Abgrenzung zwischen den staatlichen Vorschriften zum Arbeitsschutz und den Regeln und Vorschriften, die die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) erlässt, fällt manchmal schwer. Denn die staatlichen Verordnungen zur Betriebssicherheit und zu den Arbeitsstätten decken schon fast alle Themen ab, die allgemein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Unternehmen wichtig sind. Diese Vorschriften sind aber sehr abstrakt formuliert. Um die Umsetzung in die Praxis zu vereinfachen, hat die BG Verkehr bereits verschiedene Publikationen herausgebracht, an erster Stelle das Handbuch See.
Davon abgesehen gibt es aber für Seeschifffahrt und Fischerei Besonderheiten im Arbeits- und Gesundheitsschutz, die nicht durch staatliches Recht erfasst werden. Deswegen erließ die BG Verkehr nach einem langwierigen Erstellungs- und Genehmigungsverfahren eine eigene Unfallverhütungsvorschrift für diese Branche.
Auf einer Informationsveranstaltung Anfang September in Hamburg stellten Professor Werner Huth, der als ehemaliges Mitglied des Vorstandes die Entstehung dieser UVV maßgeblich begleitet hatte, sowie Martin Küppers und Kapitän Stephan Schinkel aus der Fachgruppe Seeschifffahrt der BG Verkehr die neue UVV See vor und beantworteten Fragen der Gäste. Hier eine kurze Zusammenfassung.
Fragen und Antworten - Bereich Seeschifffahrt
Warum reichen die verkehrsrechtlichen Vorschriften der Internationalen Maritimen Organisation (IMO) nicht aus?
Diese Vorschriften enthalten zwar auch einige Gesichtspunkte des Arbeitsschutzes, decken aber nicht die Anforderungen ab, die sich aus den deutschen Arbeitsschutzvorschriften ergeben.
Stehen die Vorschriften der IMO über der UVV?
Diese Vorschriften ergänzen sich, es gibt keine widersprüchlichen Forderungen. Die IMO gehört zum internationalen „Verkehrsrecht“, die Unfallverhütungsvorschrift zum deutschen „Sozialrecht“.
Sagt die UVV Seeschifffahrt auch etwas zum Notfallmanagement?
Nein, dieser Bereich ist durch Schiffssicherheitsvorschriften abschließend geregelt.
Gilt die UVV Seeschifffahrt auch für Nassbagger?
Darauf gibt es keine generelle Antwort, da die Zuständigkeiten unterschiedlich geregelt sind. Gehört das Unternehmen zur BG Verkehr, gilt die UVV Seeschifffahrt, allerdings kann es sein, dass man wegen Besonderheiten spezielle Lösungen suchen muss. Unternehmen, die Schwimmbagger betreiben, gehören meist – aber nicht immer – zur BG Verkehr, Nassbagger, die von Land aus arbeiten, dagegen meist zur BG Bau.
Was gilt für Offshoreunternehmen?
Sie sind in der Regel bei der BG ETEM versichert, mit der wir eng zusammenarbeiten. Für die Errichterschiffe oder Versetzfahrzeuge ist mit wenigen Ausnahmen die BG Verkehr zuständig.
Steht ein Monteur oder Bauarbeiter, der auf einem Seeschiff arbeitet, unter dem Schutz der Unfallversicherung?
Grundsätzlich sind Beschäftigte von deutschen Unternehmen in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert und erhalten somit im Versicherungsfall Leistungen der Gesetzlichen Unfallversicherung. Diese Leistungen sind trägerübergreifend definiert. Die von den zuständigen Unfallversicherungsträgern erlassenen Vorschriften können jedoch unterschiedlich sein. Wer auf einem Schiff tätig wird, muss die Regeln zur Unfallverhütung an Bord beachten.
Was tun, wenn Hafenstaatkontrolleure Veränderungen fordern, die der UVV See widersprechen?
Es gibt nationale Sonderregelungen in anderen Staaten, wie zum Beispiel den Code of Federal Regulations (CFR) in den USA, die beachtet werden müssen, wenn man sich in deren Hoheitsgewässern oder Häfen aufhält. Deswegen muss man vor Ort flexibel reagieren. Falls sich bestimmte Vorkommnisse wiederholen, unterstützen die BG Verkehr und die unter ihrem Dach arbeitende Dienststelle Schiffssicherheit gerne bei der Suche nach Lösungen. Die grundsätzliche Aufgabe der Hafenstaatkontrolle ist es, die Übereinstimmung mit den internationalen Übereinkommen für die Seeschifffahrt zu überprüfen. Die Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung sind kein Bestandteil der Hafenstaatkontrolle.
Darf man im Ausland Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe beschaffen, die nicht den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen?
Dies ist auf Seeschiffen in der Praxis manchmal unvermeidbar. Die neue UVV Seeschifffahrt sichert den Unternehmer dahingehend ab, dass er unter der Beachtung von in der UVV näher bestimmten Grundsätzen keinen Rechtsbruch begeht. In bestimmten Fällen muss der Unternehmer aber dokumentieren, dass er das Produkt einer qualifizierten Prüfung unterzogen hat.
Reicht zur Dokumentation die Ablage von Dokumenten auf dem Computer?
Ja, elektronische Dokumente haben Gültigkeit, es sein denn, es sind persönliche Unterschriften gefordert, zum Beispiel zur Bestätigung der Teilnahme an einer Unterweisung zum Umgang mit Gefahrstoffen.
Fragen und Antworten - Bereich Fischerei
Müssen Arbeitsschutzvorschriften auch eingehalten werden, wenn man keine Mitarbeiter beschäftigt?
Ja, die Unfallverhütungsvorschriften und damit auch die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften gelten auch für den allein arbeitenden Unternehmer, wenn er bei der BG versichert ist. Denn auch jemand, der allein arbeitet, kann sich selbst und andere gefährden.
In der Fischerei ist oft nur ein Mann an Bord, der als Unternehmer versichert ist. Muss er sich nun selbst die Erlaubnis zum Betreten gefährlicher Räume ausstellen?
Nein, natürlich nicht. Man kann nicht alles zu Papier bringen und es geht auch nicht darum, Gefahren aufzubauschen. Wenn Arbeiten mit Gefährdungspotenzial anstehen, muss der Fischer aber wissen, wie er sich zu seiner eigenen Sicherheit am besten verhält. (Das hat er mit seiner Berufsausbildung und durch langjährige Erfahrung gelernt.) Im Idealfall sollte er das auch aufschreiben.
Warum definiert die UVV Fischereifahrzeuge mit Baujahr 1995 als neu?
Das war notwendig, weil mit dem zweiten Kapitel der UVV Seeschifffahrt Bauvorschriften aus der EU-Richtlinie 93/103/EG über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit auf Fischereifahrzeugen umgesetzt werden. Die EU-Richtlinie unterscheidet bei bestimmten Anforderungen danach, ob es sich um ein vorhandenes oder ein neues Fischereifahrzeug handelt. Neue Fahrzeuge wurden hier mit dem Datum am oder nach dem 23. November 1995 definiert. Die genaue Definition befindet sich im Anhang zur UVV Seeschifffahrt.
Betrifft der Abschnitt über die Verkehrswege und den Zugang zum Schiff auch die Fischerei?
Ja, auch jeder Fischer muss für einen sicheren Zugang zu seinem Arbeitsplatz sorgen. Alle Vorschriften des ersten Kapitels der UVV Seeschifffahrt sind auch für die Fischerei verbindlich.
| Staatliche Vorschriften | Autonomes Recht und Informationen der BG Verkehr |
|---|---|
|
Gesetze |
Unfallverhütungsvorschriften |
|
Rechtsverordnungen |
DGUV Regeln |
| Eine DGUV Regel für die Branche Seeschifffahrt und Fischerei ist in Vorbereitung. Die sogenannten Branchenregeln erklären anschaulich, welche Vorschriften Gültigkeit haben und wie man sie in die Praxis umsetzt. | |
|
Informationen der BG Verkehr für die Praxis |
|
|
Der neue Leitfaden der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF) und der Internationalen Schifffahrtskammer (ICS) soll zu besseren Arbeits- und Lebensbedingungen von Seeleuten beitragen. Die Autoren erklären die verschiedenen sozialen Aspekte für eine einheitliche Umsetzung der Maritime Labour Convention.
Mit dem Internationalen Seearbeitsübereinkommen (MLC) hat die Internationale Arbeitsorganisation ILO verbindliche und weltweite Vorgaben festgelegt, mit denen Seeleute ein Recht auf angemessenes Arbeiten und Leben an Bord von Seeschiffen erhalten. Mit dem neuen englischsprachigen Leitfaden zu den sozialen Aspekten der MLC folgt nun eine praktische Anleitung für die Umsetzung der sozialen Vorgaben.
In dem Leitfaden wird erläutert, welche soziale Unterstützung zum Wohlergehen der Seeleute beiträgt. Eine wichtige Rolle im Alltag der Seeleute spielt die Nutzung des Internets an Bord und in den Häfen. Der Schutz von Minderjährigen und eine verlässliche Heuerzahlung - auch im Krankheitsfall - sind weitere Vorgaben, die unmittelbare Auswirkungen für die Seeleute haben.
Für Seeleute sind ihre Schiffe nicht nur ein Arbeitsort, sondern über große Zeiträume auch Ort, an dem sie ihre Freizeit verbringen. Seeleute aus den verschiedensten Nationen arbeiten und leben zusammen auf begrenztem Raum fern ab von Freunden und Familie. Der Leitfaden erläutert, dass diese schwierige Situation durch eine angemessene Unterkunft (z.B. gute Ausstattung, Lüftung, Heizung, adäquate Trennung des Schiffsbetriebs von den Schlafräumen), die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards (medizinische Ausstattung, sanitäre Anlagen, usw.) und die Rücksichtnahme auf persönliche Bedürfnisse (dazu zählen auch Orte für religiöse Tätigkeiten und Erholungs- und Freizeiträumlichkeiten) erleichtert werden kann. Auch der gesunden und ausgewogenen Ernährung und der Arbeitssicherheit muss an Bord Rechnung getragen werden.
Da Seeleute in der Regel nur kurze Zeit mit ihrem Schiff in einem Hafen verbleiben, ist es wichtig, dass ihnen die Orientierung an den immer neuen und fremden Orten erleichtert wird. Die Erreichbarkeit der städtischen Einrichtungen, z. B. Banken, Ärzte, Beratungsstellen, Einkaufsorte oder Freizeiteinrichtungen sowie soziale Einrichtungen (z. B. Seemannsmissionen) hat sich als wichtig erwiesen. Die Mitgliedsstaaten der ILO sollten daher die Finanzierung und Organisation der Sozialeinrichtungen an Land unterstützen.
Deutschland ist dem Seearbeitsübereinkommen (MLC) im Jahr 2013 verbindlich beigetreten. Mit dem deutschen Seearbeitsgesetz hat der Gesetzgeber die Vorgaben des Übereinkommens im deutschen Recht verankert. Für alle Beteiligten der Umsetzung dieser Vorgaben hat die deutsche Flaggenstaatverwaltung ebenfalls einen ausführlichen und jüngst überarbeiteten Leitfaden zum Seearbeitsgesetz herausgebracht. Auf den Seiten der Rubrik "Besatzung" können Sie sich außerdem weiter zu diesem Thema informieren.
Die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e. V. (BBS) hat mit Erik Hirsch (Hapag Lloyd AG) einen neuen Vorsitzenden. Hirsch löst Ernst-Peter Ebert (Reederei Bugsier) ab, der 12 Jahre lang dieses Ehrenamt innehatte.
Mit Erik Hirsch übernimmt ein Vertreter der größten deutschen Ausbildungsreederei Hapag-Lloyd das Ehrenamt in der BBS. Hirsch ist bei Hapag-Lloyd unter anderem für die Ausbildung der europäischen Seeleute verantwortlich. In seiner Antrittsrede machte er deutlich, alles Nötige zu unternehmen, um die deutsche Ausbildung in der Seeschifffahrt zu erhalten und weiter auszubauen.
Sein Vorgänger Ernst-Peter Ebert war von 2007 bis Oktober 2018 Vorsitzender der BBS und setzte sich in dieser Zeit engagiert für die Ausbildung und Interessen der Schiffsmechaniker ein. Als Vorsitzender der BBS, Personalchef einer Reederei und langjähriger Kapitän auf einem Bergungsschlepper war ihm immer bewusst, wie wichtig eine gute fundierte Ausbildung ist. "Eine gute Ausbildung ist der Schlüssel zum Erfolg einer Reederei und macht den Unterschied auf dem internationalen Markt aus", so die Überzeugung von Ernst-Peter Ebert. Mit seiner Ablösung verliert die BBS einen allseits respektierten Fachmann und Kenner der maritimen Szene.

Seit dem 14. März hat die jahrelange Diskussion um die Traditionsschifffahrt ein vorläufiges Ende gefunden. Mit einer Änderung der Schiffssicherheitsverordnung hat das Bundesverkehrsministerium die Vorschriften für Traditionsschiffe neu gefasst und damit viele umstrittene Punkte neu geregelt.
Mit der geänderten Schiffssicherheitsverordnung hat die Bundesregierung die Sicherheitsstandards für Traditionsschiffe deutlich erhöht. Erstmals enthält die Vorschrift jetzt Regelungen über Bauweise und Unterteilung, sowie Anforderungen an die Stabilität von Traditionsschiffen. Neu sind auch Bestimmungen zur Eignung und Befähigung der Besatzung. So müssen sich z.B. die Besatzungsmitglieder, die zur sicheren Mindestbesatzung gehören, nach einer Übergangszeit alle zwei Jahre auf ihre gesundheitliche Tauglichkeit hin überprüfen lassen. Die Erste-Hilfe-Ausbildung der Besatzung wird an die in der Seeschifffahrt geltenden Standards angenähert.
Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt hatte die geänderte Verordnung am 7. März unterschrieben und zeigte sich zufrieden mit den Änderungen: "Unsere Traditionsschiffe sind großartige Wahrzeichen der Schifffahrtsnation Deutschland. Dieses kulturelle Erbe wollen wir langfristig erhalten und haben die Schiffe jetzt fit für die Zukunft gemacht. Dafür haben wir gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden eine Lösung gefunden, die die Sicherheit auf historischen Schiffen für Besatzung und Passagiere erhält und stärkt."
Auch die Vertreter der Traditionsschifffahrt begrüßen die neue Verordnung und heben vor allem die Zusicherung eines Bestandsschutzes für die über 100 Traditionsschiffe in Deutschland hervor. Deren Status als Traditionsschiff wird, solange keine größeren Veränderungen vorgenommen werden, nicht neu bewertet.
Ansonsten gilt eine neue Definition des Traditionsschiffes. Ein Traditionsschiff ist nach der Verordnung "ein historisches Wasserfahrzeug, an dessen Präsentation in Fahrt ein öffentliches Interesse besteht". Als historische Schiffe gelten Originale, deren Erscheinungsbild praktisch unverändert ist. Historischen Schiffen gleichgestellt sind sogenannte Rück- und Nachbauten sowie Segelschulungsschiffe.

Zur Lösung von möglichen strittigen Fragen sollen die beiden Ombudsleute Prof. Dr. Peter Ehlers, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, sowie die ehemalige Bundestagsabgeordnete Dr. Valerie Wilms, als Vermittler zwischen den Schiffsbetreibern und der BG Verkehr als Zulassungsstelle fungieren. Die Bundesregierung hat zudem angekündigt, notwendige Umbauten von Traditionsschiffen durch Fördermittel zu unterstützen.
Neben der Traditionsschifffahrt sind auch andere Bereiche vor allem der nationalen Schifffahrt neu geregelt worden. Die bisherigen Richtlinien für verschiedene Schiffsarten sind jetzt mit wenigen redaktionellen Änderungen in die geänderte Schiffssicherheitsverordnung übernommen worden. Die alte Schiffssicherheitsverordnung aus dem Jahr 1986, auf die noch in Teilen zurückgegriffen wurde, ist jetzt außer Kraft gesetzt worden.
Eine weitere Änderung der Verordnung betrifft kleinere Schiffe, die in den Bodden, Haffen und Förden der Ostsee unterwegs sind, also im Übergangsbereich zwischen dem Binnen- und dem Seebereich. Diese Schiffe - vor allem kleinere Fischereifahrzeuge - unterliegen nach einer Übergangsfrist von einem Jahr wieder den See-Vorschriften, wenn sie keine Zulassung nach der Binnenschiffsuntersuchungsordnung haben.
Wer kennt nicht das bekannte Seemannslied "What shall we do with the drunken sailor?". Das Klischee von betrunkenen Seeleuten ist auch heute noch weit verbreitet. Dabei konsumieren Seeleute nicht mehr Alkohol als die durchschnittliche deutsche Bevölkerung. Das ist ein Ergebnis einer Fachkonferenz, die vor kurzem in Hamburg stattfand.
Gut hundert Fachleute waren am 14. Februar zu dem Wissenschaftlichen Symposium "Alkohol, Drogen, Verkehrseignung - Schifffahrt" nach Hamburg gekommen, um den sechs Fachvorträgen zu folgen. Der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (B.A.D.S.) und das Institut für Rechtsmedizin am UKE hatten die Konferenz organisiert.
Die Vortragenden aus den Bereichen Schifffahrtsmedizin, Gerichtswesen, Wasserschutzpolizei und Medizinunternehmen machten deutlich, dass der Beruf des Seemanns zu den sogenannten risikoreichen Stressberufen gehört. Im Vergleich zu Landberufen seien Seeleute deutlich mehr Stressfaktoren ausgesetzt - wie zum Beispiel Wettereinflüssen, soziale Isolation, Schichtdienst und langen Arbeitszeiten und Piraterie.
Trotz dieser erhöhten Anforderungen gebe es aber keine Belege dafür, dass Seeleute mehr Alkohol konsumieren würden als die Durchschnittsbevölkerung. Die Wasserschutzpolizei stellte im Jahr 2016 im Hamburger Hafen nur fünf Fälle von übermäßigen Alkohol- und Drogengenuss in der Binnen- und Seeschifffahrt fest. Regelmäßige und verstärkte Alkohol- und Drogenkontrollen seien aber wichtig, da die möglichen Schäden durch Trunkenheitsfahrten in der Seeschifffahrt deutlich höher seien als im Straßenverkehr.
Keine Einigkeit gab es bei der Frage, ob für die Seeschifffahrt generell eine Null-Promille-Grenze eingeführt werden soll, wie sie für Fahrgastschiffe und Schiffe mit gefährlichen Gütern bereits jetzt gilt. Einige Reedereien verbieten den Alkohol- und Drogenkonsum an Bord ihrer Schiffe. Auf der anderen Seite, so einige Experten, müsse man berücksichtigen, dass für Seeleute ein Schiff nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern zugleich auch Wohnort über mehrere Monate ist.





