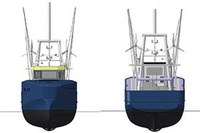Nachrichten 2023
Die Ostseeanrainer haben sich erstmals auf einen einheitlichen Höhenbezug für Seekarten geeinigt: das Baltic Sea Chart Datum 2000. Je genauer es definiert ist, umso sicherer und effizienter können Schiffe navigieren. Das BSH und das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) haben dafür hochpräzise Messungen der Erdanziehungskraft mit den Schiffen DENEB und CAPELLA durchgeführt. Das ist die Voraussetzung, um Wassertiefen zentimetergenau bestimmen zu können. (15.12.2023)
„Die Ostsee ist ein relativ flaches Meer, in dem viele Schiffe unterwegs sind. Genaue Wassertiefen sind hier essentiell für eine sichere Schifffahrt“, betont BSH-Präsident und Professor Helge Heegewaldt. So können Schiffe bestmöglich beladen und Routen effizienter geplant werden. „Ein einheitlicher Höhenbezug von Seekarten ist auch für die Digitalisierung sowie zahlreiche Offshore-Vorhaben und langfristigen Küstenschutz notwendig“, erläutert BKG-Präsident Prof. Dr. Paul Becker.
Im November 2023 veröffentlichte die Internationale Hydrographische Organisation (IHO) ein neues Modell für den gesamten Ostseeraum, um die Höhenbezugsfläche grenzübergreifend zu definieren. Das Modell legt gleichzeitig das neue Seekartennull fest, welches Deutschland bereits seit 2022 verwendet. Die Wassertiefen in den Seekarten des BSH ändern sich daher nicht.
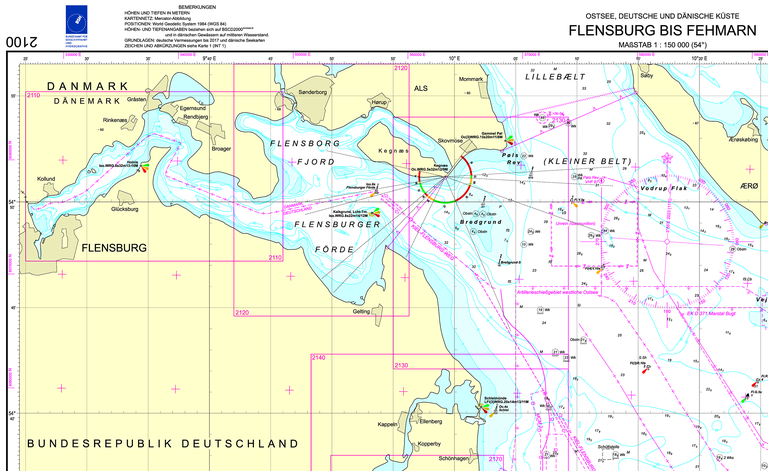
Meeresoberfläche weist Dellen und Beulen auf
Die Höhenbezugsfläche hängt vom Schwerefeld der Erde ab. BSH und BKG haben daher in den vergangenen zehn Jahren umfangreiche Vermessungen in der Ostsee durchgeführt. Gebiete mit höherer Schwerkraft ziehen das Wasser stärker an und erzeugen eine Beule. Umgekehrt ziehen Gegenden mit geringerer Schwerkraft das Wasser weniger stark an, sodass eine Delle entsteht. Es gilt solche Unregelmäßigkeiten der Erdanziehungskraft genau zu kartieren.
Dafür benötigten BSH und BKG nicht nur relativ viele Messpunkte, sondern die Messungen selbst mussten sehr präzise sein. Diese Informationen sind für die satellitengestützte Navigation unerlässlich, um Tiefen exakt im Raum zu verorten. Die Wassertiefen in den Seekarten sind nun zentimetergenau. Die Vermessungen wurden im Rahmen des Projekts „Finalizing Surveys for the Motorways of the Sea“ (FAMOS) durch die Europäische Union kofinanziert.
Internationale Zusammenarbeit für Mensch und Meer
Bisher verwendete jeder Ostseeanrainer ein eigenes, lokales Seekartennull. Die Hydrographische Kommission für die Ostsee (BSHC) hat daher eine Arbeitsgruppe beauftragt, ein einheitliches Seekartennull für die gesamte Ostsee zu entwickeln. BSH und BKG waren maßgeblich daran beteiligt. Nun führen alle Ostseeanrainer das einheitliche Seekartennull ein. Dadurch können globale Satellitennavigationssysteme einfacher für die Navigation verwendet werden. Dies ebnet ebenfalls den Weg für eine zunehmend automatisierte Schifffahrt, die effizienter und sicherer ist.
Weitere Informationen:
- zum Baltic Sea Chart Datum 2000 von der Hydrographische Kommission für die Ostsee (in Englisch)
- zur Veröffentlichung des Baltic Sea Chart Datum 2000 von der Internationalen Hydrographischen Organisation (in Englisch)
- Nachrichten für Seefahrter Heft 52/21– Mitteilungen (bsh.de)
- zu den Schwerefeldmessungen in Nordsee und Ostsee (in Englisch)
Die Internationale Fernmeldeunion ITU hat in den letzten Jahren mehrere Änderungen des Anhangs 18 der Vollzugsordnung für den Funkdienst (Radio Regulations) beschlossen. Dadurch ändern sich auch Frequenzen für den UWK-Seefunk – und das wiederum macht Modifikationen der UKW-Funkausrüstung auf Seeschiffen erforderlich.
Reedereien müssen die UWK-Funkausrüstungen an Bord ihrer Seeschiffe unter Deutscher Flagge spätestens bis zur ersten Besichtigung der Funkanlage nach dem 1.1.2028 aktualisiert haben. Damit folgt die Deutsche Flagge den Empfehlungen des IMO-Rundschreibens MSC.1/Circ.1460/Rev.4. Die ordnungsgemäße Nutzung der neuen Frequenzen auf Seeschiffen unter Deutscher Flagge sowie bei Hafenstaatkontrollen in deutschen Häfen wird daher erst ab dem 1.1.2028 überprüft und eventuelle Verstöße erst ab diesem Zeitpunkt geahndet.
Ursprünglich sollten die Änderungen der UKW-Funkanlagen einschließlich der neuen Frequenzen bereits ab dem 1.1.2024 gelten (vgl. IMO-Rundschreiben MSC.1/Circ.1460/Rev.3). Mit der jetzt erfolgten Verschiebung erhalten Reedereien mehr Zeit, die Seefunkanlagen an Bord ihrer Schiffe trotz derzeitiger Lieferengpässe fristgerecht umzustellen.
Die neuen Frequenzen sollen für meteorologische und navigatorische Zwecke, dringende Seeverkehrsinformationen, Hafenbetrieb und Schiffsverkehrsdienste (VTS) genutzt werden. Das Weltweite Seenot- und Sicherheitsfunksystem (GMDSS) ist dagegen nicht von den Änderungen betroffen.
Die aktuelle Fassung der Vollzugsordnung für den Funkdienst (Radio Regulations) einschließlich des Anhangs 18 können Sie auf der Website der Internationalen Fernmeldeunion ITU herunterladen.
Vor kurzem war im "Nordmagazin" des NDR ein Beitrag über die medizinische Versorgung an Bord der Scandlines-Fähre "Berlin" zu sehen. Dabei hob der Kapitän den hohen Praxiswert des Medizinischen Handbuchs See hervor. (12.12.2023)
 Der 3-minütige Beitrag des NDR-"Nordmagazins" aus Mecklenburg-Vorpommern zeigt, wie der Kapitän der deutschflaggigen Fähre "Berlin" bei medizinischen Notfällen an Bord verletzte oder erkrankte Personen auch ohne Schiffsarzt versorgen kann. Neben dem Notfall-Rucksack spielt das Medizinische Handbuch See des Seeärztlichen Dienstes der BG Verkehr eine große Rolle. Stefan Wehland, Kapitän der "Berlin", hebt in dem TV-Beitrag hervor, warum das Handbuch gerade im Notfall für ihn ein wichtiger praktischer Ratgeber ist: "Angina pectoris, Lungenembolie, verschiedene Spannungspneumothorax – das dürfte ein medizinischer Laie an Land im Leben nicht machen".
Der 3-minütige Beitrag des NDR-"Nordmagazins" aus Mecklenburg-Vorpommern zeigt, wie der Kapitän der deutschflaggigen Fähre "Berlin" bei medizinischen Notfällen an Bord verletzte oder erkrankte Personen auch ohne Schiffsarzt versorgen kann. Neben dem Notfall-Rucksack spielt das Medizinische Handbuch See des Seeärztlichen Dienstes der BG Verkehr eine große Rolle. Stefan Wehland, Kapitän der "Berlin", hebt in dem TV-Beitrag hervor, warum das Handbuch gerade im Notfall für ihn ein wichtiger praktischer Ratgeber ist: "Angina pectoris, Lungenembolie, verschiedene Spannungspneumothorax – das dürfte ein medizinischer Laie an Land im Leben nicht machen".
Im Notfall sind nämlich Kapitäne und Schiffsoffiziere weitgehend auf sich allein gestellt, denn nur auf großen Kreuzfahrt- und Forschungsschiffen fahren Ärzte mit. Umso wichtiger sind die medizinischen Wiederholungslehrgänge für Kapitäne und Schiffsoffiziere, die sie alle fünf Jahre absolvieren müssen. Der NDR begleitete Nautiker bei einem dieser Kurse am Campus der Rostocker Uniklinik. Auch für die Zulassung dieser Kurse ist Seeärztliche Dienst der BG Verkehr zuständig.
Nicht zuletzt haben Nautiker und Schiffsoffiziere auch die Möglichkeit, sich in medizinischen Notlagen funkärztlich beraten zu lassen. Diese Aufgabe wird im Auftrag der BG Verkehr durch die Helios-Klinik Cuxhaven erfüllt. Rund 1.300 Anfragen gehen jährlich beim Funkärztlichen Beratungsdienst Cuxhaven ein. Das zeigt, wie wichtig eine optimale medizinische Versorgung an Bord ist. Die Deutsche Flagge setzt hier Top-Standards – mehr dazu auf unserer Website.
Der Filmbeitrag ist in der ARD-Mediathek abrufbar.
Für die Reedereien, welche Seeschiffe ab 5000 BRZ betreiben, sind jetzt ab dem 01.01.2024 folgende Arbeiten zur Anmeldung in das EU-Emissionshandelssystem (ETS) durchzuführen:
- Alle am Emissionshandel teilnehmenden Akteure müssen ein Konto im Unionsregister eröffnen, das von der Europäischen Kommission bereitgestellt wird. Die Verwaltung des deutschen Teils des Unionsregisters sowie die Bearbeitung von Kontoanträgen erfolgen durch die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt). In diesem Register wird für jedes Schifffahrtsunternehmen im Sinne der Definition der Emissionshandelsrichtlinie ein Registerkonto (maritime operator holding account) eröffnet. Die Abgabetransaktionen der erworbenen Emissionsberechtigungen können ausschließlich über dieses Konto erfolgen. Es können auch mehrere Schiffe in einem Konto des Unternehmens erfasst werden.
- Nach aktuellem Stand soll die Eröffnung dieser Registerkonten (maritime operator holding account) für den Seeverkehr ab April 2024 möglich sein. Sobald die novellierte EU-Registerverordnung, die dann auch den maritimen Sektor berücksichtigt, verabschiedet wurde, werden Hilfestellungen und Informationen zur Einrichtung sowie Nutzung der Konten bereitgestellt.
Das Emissionshandelssystem wird in Übereinstimmung mit Verordnung (EU) 2023/957 und Durchführungsverordnung (EU) 2023/2599 angewendet.
Reeder können sich jederzeit an den Kundenservice der DEHSt wenden unter: emissionshandel@dehst.de oder sich bei Fragen in den FAQs informieren.
Für weitere Fragen steht Ihnen die Dienststelle Schiffssicherheit in Hamburg unter Tel.: +49 40 36 137 217 oder E-mail: maschine@bg-verkehr.de gerne zur Verfügung.
Seit dem 4. Dezember 1998 ist das Vermessungsschiff (VS) KOMET des BSH im Einsatz. Die KOMET macht topographische Aufnahme des Meeresbodens der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) vorwiegend der Nordsee und des Wattenmeeres. Heimathafen ist Hamburg. Stationiert ist die KOMET im Fischereihafen Bremerhaven. (04.12.2023)
Anlässlich des Jubiläums des Vermessungsschiffes betont BSH-Präsident Helge Heegewaldt die Bedeutung der Vermessung für die Nutzung und den Schutz der Meere. „Vermessungsdaten sind die Basis von Seekarten. Sie machen Schifffahrt sicher. Dank ihnen können Positionen, an denen meereskundliche Daten erhoben werden, genau verortet werden. Dadurch ist es uns möglich, an den gleichen Positionen über Jahre die gleichen Daten zu erheben, um damit Entwicklungen des Zustands der Meere zu verfolgen und gegebenenfalls gegenzusteuern. Vermessungsdaten sind die Basis für die maritime Raumordnung, damit auch für die Positionierung zum Beispiel von Flächen für den Ausbau der Offshore-Windenergie“. Heegewaldt dankt den Besatzungsmitgliedern für die hervorragende Arbeit. „Insgesamt 332.000 Seemeilen sind Sie mit der KOMET und ihren vier Vermessungsbooten unterwegs gewesen. Sie sind also 15 Mal auf dem Äquator um die Erde gefahren. Das gibt einen Eindruck Ihrer Vermessungsarbeiten!“

Die 64,20 Meter lange und 12,50 Meter breite KOMET bietet Platz für 18 Besatzungsmitglieder und sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Einsatzradius der KOMET beträgt 5400 Seemeilen. Das Schiff kann bis zu 21 Tage auf See bleiben.
Für die Vermessungsarbeiten ist das Schiff mit entsprechender Technologie wie Vermessungsloten, präziser Satellitenpositionierung und einer inertialen Messeinheit für eine präzise Datenerfassung ausgerüstet. Vier flachgehende Vermessungsboote ergänzen die Ausstattung. Damit sie selbstständig in flachen Gewässern wie dem Wattenmeer arbeiten können, sind .sie mit Echoloten und Datenaquisitionsanlagen ausgerüstet. Eines der Boote kann bei Bedarf mit einem Side-Scan-Sonar für die Untersuchung von Unterwasserhindernissen ausgerüstet werden.
Das BSH betreibt die KOMET mit synthetischem Gas-to-liquid (GtL)-Treibstoff. Er ist schwefelfrei. Damit werden bessere Abgaswerte als bei herkömmlichen Dieselkraftstoffen erreicht. Der Rumpf des Schiffes ist eisverstärkt und mit der Eisklasse "E" klassifiziert. Das VS KOMET kann also bis zu einer Eisdicke von 0,15 m eingesetzt werden.
Die heutige Lürssen-Kröger-Werft in Schacht-Audorf erbaute die KOMET. Nach der Kiellegung am 12. September 1997 erfolgte der Stapellauf am 12. März 1998. Am 4. Dezember 1998 wurde sie als damals modernstes Vermessungsfahrzeug der Welt in Dienst gestellt.
Fünf Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiffe (VWFS) des BSH operieren in der AWZ von Nordsee und Ostsee. Die VWFS ATAIR, DENEB und WEGA setzt das BSH neben der Vermessung und Wracksuche für Prüfungen zur weiteren Verbesserung der Schiffssicherheit, für Messungen in Offshore-Windparks und für chemisches und physikalisches Monitoring ein. Ausschließlich für die Vermessung im Einsatz sind KOMET und CAPELLA. Die KOMET ist nach dem VWFS ATAIR das zweitgrößte Schiffe der BSH-Flotte.
Passend zum "Jahr der Ausbildung" hat der Verband Deutscher Reeder (VDR) seine Website erweitert und informiert jetzt über die verschiedenen Karrierewege in die Seeschifffahrt. Neu ist auch der Flyer zum VDR-Ferienfahrerprogramm. Die Deutsche Flagge als die Ausbildungs-Flagge unterstützt dabei aktiv die Seefahrt-Ausbildung. (04.12.2023)
Unter www.reederverband.de/de/ausbildung erhalten Interessierte einen Überblick über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten in der Seefahrt. Unter dem Slogan "Wenn Dir Schifffahrt nicht aus dem Kopf geht" werden die Aufgaben und Ausbildungswege von Kapitänen, Chiefs, Schiffsmechanikern, Elektrotechnischen Schiffsoffizieren sowie Schifffahrtskaufleuten vorgestellt.
Mehr über den "Traumjob an Bord" und die abwechslungsreiche Welt der Seefahrt erfahren Interessierte auch im neuen FAQ-Bereich. Außerdem enthalten die Ausbildungs-Seiten des VDR die wichtigsten Informationen über das Ferienfahrerprogramm des Reederverbands, das Schülerinnen und Schülern einen praktischen Einblick in die Seefahrt ermöglicht. Abgerundet wird das neue Informationsangebot durch den knapp 3-minütigen Film "Faszination Schifffahrt", in dem junge Auszubildende sehr überzeugend darüber berichten, warum sie sich für eine Karriere in der Seeschifffahrt entschieden haben.

Die neuen Ausbildungsseiten des VDR ergänzen die bereits bestehende Website www.machmeer.de der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt, die alle wichtigen Infos zur Ausbildung in der Seeschifffahrt bietet und sich vor allem an junge Menschen richtet.
Zu Jahresbeginn hatte der VDR das Jahr 2023 zum "Jahr der Ausbildung" ausgerufen und mit Holger Jäde einen erfahrenen Referenten für Ausbildung eingestellt (vgl. unsere Nachricht vom 3.1.2023). Außerdem hatte der VDR auf seinem Ausbildungsforum am 13. September zugesagt, 400 seeseitige und 200 landseitige Ausbildungsplätze bei seinen Mitgliedsunternehmen bereitzustellen (vgl. unsere Nachricht vom 20.9.2023).
Die Deutsche Flagge ist die Ausbildungs-Flagge und unterstützt aktiv die Seefahrt-Ausbildung. Der Bund fördert finanziell Reedereien, die neue Ausbildungsplätze schaffen – und das sind hauptsächlich Unternehmen, die ihre Schiffe unter Deutscher Flagge fahren. Mehr als 80% der von der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt anerkannten Ausbildungsschiffe fahren unter Deutscher Flagge. Unser Ausbildungs-Rechner zeigt, dass sich für Reedereien die Seefahrt-Ausbildung in jedem Fall lohnt.
Das BSH organisierte am 29. November 2023 den ersten Runden Tisch Unterwasserlärm und Schifffahrt in Hamburg. Kooperationspartner sind der Verband Deutscher Reeder (VDR), der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) und der Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V. (VSM). Im Fokus standen die neuen internationalen Richtlinien, um den schifffahrtsbedingten Unterwasserlärm zu verringern. (01.12.2023)
„Nur gemeinsam können wir es schaffen, dass die Meere leiser werden“, betont BSH-Präsident Helge Heegewaldt. „Von daher freue ich mich, dass das Interesse an dem ersten Runden Tisch zum Thema Unterwasserlärm und Schifffahrt so groß war.“ Heegewaldt fordert, dass die neuen Richtlinien schnellstmöglich in die Umsetzung kommen, denn nur so können sie wirksam werden.
Die Schifffahrt ist eine der Hauptquellen für dauerhaften Unterwasserlärm, der das Leben im Meer beeinflusst. Was können wir beitragen, um den Unterwasserlärm zu reduzieren? Welche Möglichkeiten gibt es und welche haben sich bisher in der Praxis bewährt? Derartige Fragen haben rund 70 Interessierte aus Schifffahrt und Technik, Verwaltung und Verbänden sowie der Wissenschaft beim Runden Tisch diskutiert.
Erfahrungen aus der Praxis zu neuen Richtlinien
Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat in diesem Jahr neue Richtlinien verabschiedet, um den Unterwasserlärm von Schiffen zu reduzieren. Sie fassen den aktuellen Stand des Wissens zusammen und geben einen Überblick über technische und operative Maßnahmen. Dazu zählt zum Beispiel die Geschwindigkeit zu reduzieren. Außerdem enthalten sie Vorlagen für einen Unterwasserlärm-Managementplan.
Beim Runden Tisch tauschten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu aus, welche Herausforderungen und Möglichkeiten sie bei der Umsetzung der Richtlinien in der Praxis sehen. So diskutierten sie bestmögliche Techniken und Praktiken. Darüber hinaus informierten sie sich über aktuelle Forschungsprojekte und innovative Technologieentwicklungen. Dabei identifizierten sie weiteren Forschungsbedarf.
Weniger Unterwasserlärm für Mensch und Meeresumwelt
Die Richtlinien tragen dazu bei, den schifffahrtsbedingten Unterwasserlärm und damit die negativen Auswirkungen auf Meereslebewesen zu verringern. Der Zustand der Meere wird so verbessert. Dabei können auch Synergien mit anderen Maßnahmen genutzt werden, die beispielsweise die Emissionen von Treibhausgasen reduzieren.
Zukünftig treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mindestens einmal im Jahr beim Runden Tisch. Bis dahin wollen sie thematische Arbeitsgruppen gründen. So können die internationalen Richtlinien ihre Wirksamkeit entfalten.
 Weihnachten ist für viele die Zeit der Familie und des Beisammenseins. Für viele Seeleute erscheinen die hunderte Kilometer, die sie und ihre Familien trennt, in dieser Zeit besonders weit und das Gefühl der Einsamkeit ist groß. Neben anderen Aktionen sammeln deshalb die Seemannsmissionen in Hamburg unter dem Motto "Christmas in a Box" Geschenke für Seeleute – zusammengestellt und verpackt von jedem/jeder, der/die Lust und Zeit hat.
Weihnachten ist für viele die Zeit der Familie und des Beisammenseins. Für viele Seeleute erscheinen die hunderte Kilometer, die sie und ihre Familien trennt, in dieser Zeit besonders weit und das Gefühl der Einsamkeit ist groß. Neben anderen Aktionen sammeln deshalb die Seemannsmissionen in Hamburg unter dem Motto "Christmas in a Box" Geschenke für Seeleute – zusammengestellt und verpackt von jedem/jeder, der/die Lust und Zeit hat.
So kann man mitmachen:
- Ein Karton möglichst in etwa der Größe eines Schuhkartons
- darein kommen
- Kleidung, wie Socken, Mütze, Handschuhe
- Süßigkeiten
- Hygieneartikel wie Deo, Duschgel, Shampoo, Zahnpasta
- Ein möglichst englischsprachiger Weihnachtsgruß
- Weihnachtsdekoration
- auf den Schiffen herrschen strenge Sicherheitsauflagen; daher: Keine echten Kerzen, kein Alkohol, kein Obst.
- und dann in weihnachtliches Geschenkpapier verpacken
Geschenke für Seeleute können noch bis zum 23. Dezember an folgenden Stellen der Aktion "Christmas in a Box" abgegeben werden:
- Deutsche Seemannsmission Hamburg e.V., Seemannsheim Hamburg, direkt hinter dem „Michel“, Krayenkamp 5
- DUCKDALBEN international seamen´s club, Waltershof, Zellmannstraße 16
- Deutsche Seemannsmission Hamburg Altona e.V./nahe Fischmarkt, Seemannshotel, Große Elbstraße 132
- Katholische Seemannsmission „Stella Maris, Ellerholzweg 1a
Das Ostfriesische Landesmuseum Emden zeigt in einer Sonderausstellung die Hintergründe des Untergangs des deutschflaggigen Schiffes "Melanie Schulte" im Dezember 1952. Das spurlose Verschwinden des in Emden gebauten Schiffes und der Tod der 35 Besatzungsmitglieder erregte damals viel Aufmerksamkeit – und bewegt auch heute noch. (24.11.2023)
Am 21.12.1952 gab der Funker der "Melanie Schulte" eine Meldung ab, nach der sich das Wetter im Seegebiet rund um das Schiff verschlechtern werde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Schiff im Nordatlantik etwa 90 Seemeilen westlich der schottischen Inselgruppe der Hebriden. Es sollte das letzte Lebenszeichen der 35-köpfigen Besatzung bleiben. Seitdem ist das Schiff spurlos verschwunden.
Seegebiet rund um das Schiff verschlechtern werde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Schiff im Nordatlantik etwa 90 Seemeilen westlich der schottischen Inselgruppe der Hebriden. Es sollte das letzte Lebenszeichen der 35-köpfigen Besatzung bleiben. Seitdem ist das Schiff spurlos verschwunden.
Der Untergang der "Melanie Schulte" war damals für die Angehörigen der Seeleute ein Schicksalsschlag. In den Medien und der Öffentlichkeit erregte das Unglück viel Aufmerksamkeit. Viele Fragen blieben unbeantwortet: Hatte der Kapitän eine falsche Route gewählt und das Schiff war auf ein unterseeisches Felsenriff aufgelaufen? Brach der Stückgutfrachter, der Erz geladen hatte, im schweren Seegang auseinander? Oder hatte der missglückte Stapellauf auf der Emder Schiffswerft am 9. September 1952, als das Schiff auf der Ablaufbahn steckenblieb, die Rumpfstrukturen des Schiffes beschädigt?
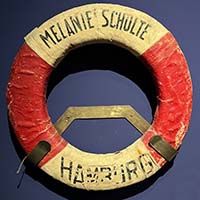 Die Ausstellungsmacher haben Akten gesichtet sowie Angehörige und Fachleute befragt. Sie räumen auf mit Gerüchten und Mythen, die seit über 70 Jahren über den Untergang der "Melanie Schulte" erzählt werden. Jede mögliche Ursache für das Unglück wird dargestellt, analysiert und bewertet.
Die Ausstellungsmacher haben Akten gesichtet sowie Angehörige und Fachleute befragt. Sie räumen auf mit Gerüchten und Mythen, die seit über 70 Jahren über den Untergang der "Melanie Schulte" erzählt werden. Jede mögliche Ursache für das Unglück wird dargestellt, analysiert und bewertet.
Vollständige Gewissheit über die Ursachen des Untergangs der "Melanie Schulte" wird es dagegen wohl nie geben. Das Seeamt Hamburg kam nach seiner Verhandlung im April 1953 zu folgendem Schluss:
"Die Ursache des Unfalls ist nicht ermittelt, weil Augenzeugen der Katastrophe nicht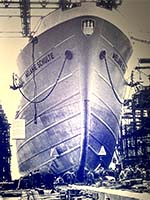 vorhanden sind. Hierüber sind nur Vermutungen, jedoch keine bestimmten Feststellungen möglich. Wahrscheinlich hat das Zusammentreffen einer ungewöhnlichen Schlechtwetterlage einschließlich Wind und See und Dünung und den hierdurch bedingten Resonanzen der Schiffseigenperioden mit der Seegangsperiode zu einer derart hohen Druckbeanspruchung im Schiff geführt, dass ein so schnelles Zusammenbrechen des Schiffes erfolgt ist, dass auch zur Abgabe eines Funkspruches keine Möglichkeit mehr bestand."
vorhanden sind. Hierüber sind nur Vermutungen, jedoch keine bestimmten Feststellungen möglich. Wahrscheinlich hat das Zusammentreffen einer ungewöhnlichen Schlechtwetterlage einschließlich Wind und See und Dünung und den hierdurch bedingten Resonanzen der Schiffseigenperioden mit der Seegangsperiode zu einer derart hohen Druckbeanspruchung im Schiff geführt, dass ein so schnelles Zusammenbrechen des Schiffes erfolgt ist, dass auch zur Abgabe eines Funkspruches keine Möglichkeit mehr bestand."
Die Sonderausstellung "Melanie Schulte - Schiff, Unglück, Mythos" läuft noch bis zum 28. Januar 2024 im Ostfriesischen Landesmuseum in Emden.
Die Schifffahrt steht vor einer Trendwende: Ab 2026 sollen Seekarten nicht nur vollständig digitalisiert, sondern auch dynamisch sein. Im neuen Interreg-Projekt „Baltic Sea e-nav“ entwickelt das BSH zusammen mit 14 Partnern aus 9 Ländern die nächste Generation von elektronischen Seekarten sowie weitere nautische Produkte am Beispiel der Ostsee. So wird die Schifffahrt effizienter, sicherer und nachhaltiger. (21.11.2023)
Die hydrographischen Dienste standardisieren und harmonisieren die Datenformate und Schnittstellen in der digitalen Schiffsnavigation. Dies ist wichtig, um sie schnellstmöglich in der internationalen Schifffahrt zu etablieren. „Die Ostsee ist das perfekte Testfeld für neue Anwendungen. Wenn wir es hier schaffen, können wir es überall schaffen“, verkündete der Generalsekretär der Internationalen Hydrographischen Organisation (IHO) Dr. Mathias Jonas.
Neben der elektronischen Seekarte sollen verschiedene Informationen schiffs- und situationsabhängig bereitgestellt werden. „So können beispielsweise Routen und Beladung in Echtzeit optimiert, Sicherheit für Mensch und Umwelt erhöht und Umweltauswirkungen reduziert werden. Dies ebnet den Weg für eine zunehmend automatisierte und autonome Schifffahrt, die immer mehr an Bedeutung gewinnt“, betont BSH-Präsident Helge Heegewaldt.
Für die Bedürfnisse von Seeleuten entwickelt
Die Grundlage für digitale Produkte und Dienstleistungen bildet ein neues Datenmodell der IHO: das S-100 Universal Hydrographic Data Model. Dies ist notwendig, um elektronische Seekarten herzustellen und entsprechende Datenprodukte zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören beispielsweise Informationen über den Meeresboden, sowie Wasserstände und Strömungsverhältnisse an der Oberfläche.
Im nächsten Schritt sind die internationalen Standards umzusetzen. Hier setzt das neue Projekt an, das im November 2023 begann. Es umfasst die gesamte Prozesskette von der Produktentwicklung bis hin zum Vertrieb der Navigationsdaten an die Endverbraucher. Neben den hydrographischen Diensten wie dem BSH sind daher auch Forschungsinstitute, Hersteller von Navigationssystemen und Lieferanten von Navigationsdaten beteiligt.
Ziel ist es, die nächste Generation von elektronischen Seekarten und weitere nautische Produkte einzuführen. Das Projekt wird mit 4,9 Millionen Euro über das europäische Interreg-Ostseeprogramm finanziert. Bis Herbst 2026 liefert es am Beispiel der Ostsee die grundlegenden Daten für die zukünftigen Navigationssysteme in der Schifffahrt. Denn nur gemeinsam können die Seekarten der Zukunft etabliert werden.
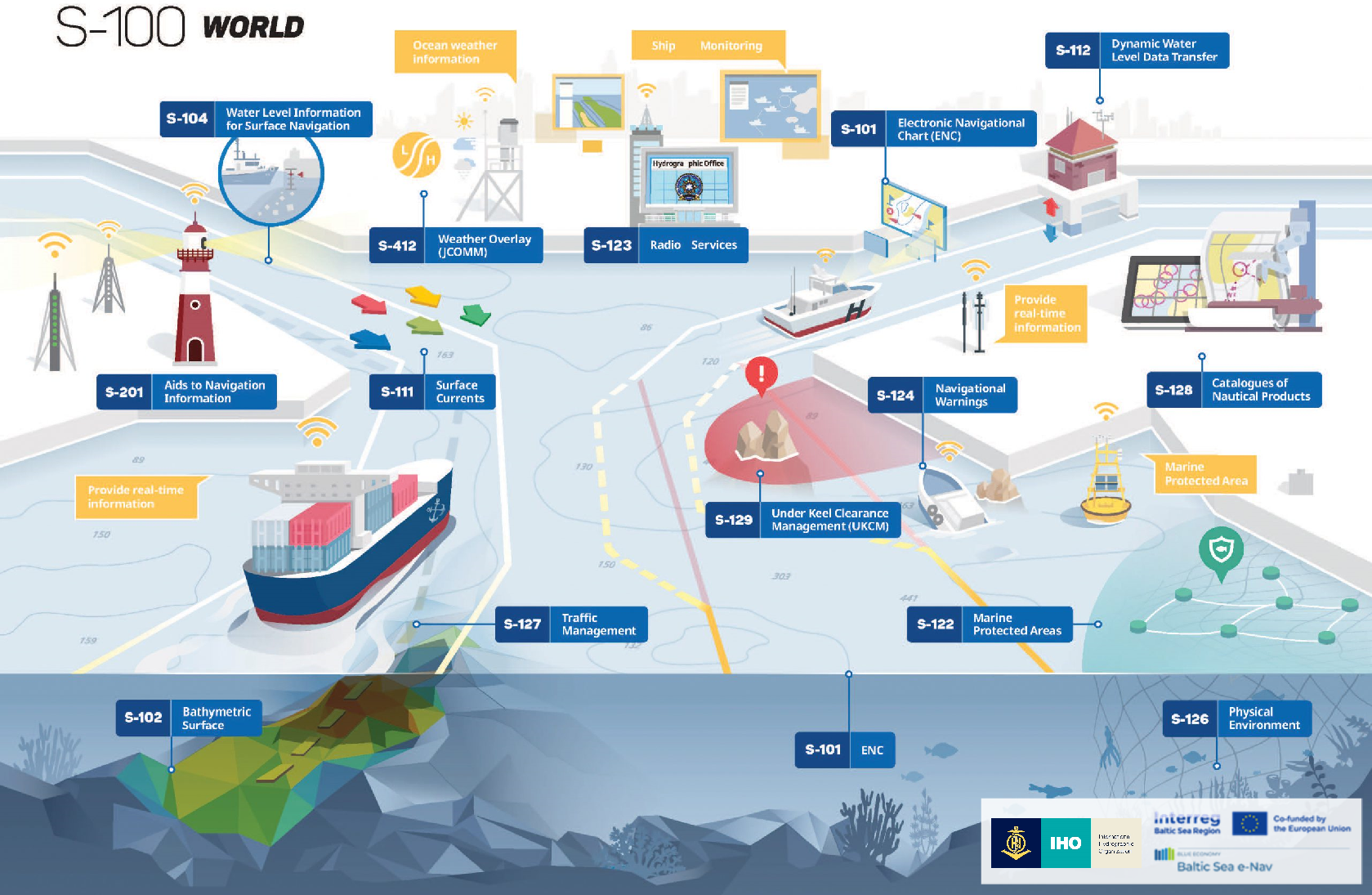
Der Verband Deutscher Reeder (VDR) und die Gewerkschaft ver.di haben sich auf eine Erhöhung der Tarifheuern für Seeleute um insgesamt 10,5% in zwei Schritten geeinigt. Die höheren Heuern des Heuertarifvertrags See (HTV See) gelten rückwirkend zum 1. Oktober für alle Reedereien in der VDR-Tarifgemeinschaft. (15.11.2023)
 6,5% mehr Heuern rückwirkend zum 1. Oktober und nochmals 4,5% ab Oktober 2024 – das ist das Hauptergebnis der zweiten Verhandlungsrunde zum Heuertarifvertrag See (HTV See) zwischen dem Verband Deutscher Reeder (VDR) und der Gewerkschaft ver.di. Für die gesamte Laufzeit des neuen Tarifvertrages bis Ende 2025 ergibt sich damit eine Erhöhung der Heuern um insgesamt 10,5%.
6,5% mehr Heuern rückwirkend zum 1. Oktober und nochmals 4,5% ab Oktober 2024 – das ist das Hauptergebnis der zweiten Verhandlungsrunde zum Heuertarifvertrag See (HTV See) zwischen dem Verband Deutscher Reeder (VDR) und der Gewerkschaft ver.di. Für die gesamte Laufzeit des neuen Tarifvertrages bis Ende 2025 ergibt sich damit eine Erhöhung der Heuern um insgesamt 10,5%.
Der neue HTV See wird eine Öffnungsklausel enthalten, welche die Entgeltumwandlung zur Finanzierung von Jobrad-Angeboten ermöglicht. Speziell für Schleppschiffe im Offshore-Bereich haben sich die Tarifpartner auf eine Zulage geeinigt, deren Höhe noch von den Betriebsparteien ausgehandelt werden muss.
VDR und ver.di haben eine vierwöchige Erklärungsfrist vereinbart, in der sie sich in ihren internen Gremien über die Verhandlungsergebnisse beraten können. Bis zum Ende dieser Frist kann das Tarifergebnis auch widerrufen werden.
Der Heuertarifvertrag See (HTV See) gilt für alle Reedereien, die Mitglied in der Tarifgemeinschaft des VDR sind, darunter zum Beispiel Hapag-Lloyd und TT-Line. Von der Erhöhung der Heuern profitieren diejenigen Seeleute, in deren Heuerverträgen die Anwendung des HTV See ausdrücklich vereinbart wurde.
Mehr Infos zum Thema Tarifverträge gibt es auf unserer Website. Dort werden Sie auch den neuen HTV See finden, sobald er von den Tarifpartnern veröffentlicht worden ist.
Auch im nächsten Jahr bleibt die Situation für die deutschen Ostseefischer schwierig. Nach den aktuellen Beschlüssen der EU-Fischereiminister dürfen Dorsch und Hering im Bereich der westlichen Ostsee nicht gezielt befischt werden. Die Stellnetz- und Reusenfischerei auf Hering mit kleineren Kuttern ist dagegen möglich. (27.10.2023)
 Die EU-Fischereiminister haben für 2024 eine Senkung der erlaubten Fangmenge für die deutschen Fischer auf Dorsch in der westlichen Ostsee um 30 Prozent auf 73 Tonnen beschlossen. Damit darf Dorsch – der ehemalige "Brotfisch" der Ostseefischer – weiterhin nicht gezielt, sondern nur als Beifang gefischt werden. Das Gleiche gilt für den Hering, bei dem die deutsche Quote mit 435 Tonnen gegenüber dem laufenden Jahr konstant bleibt.
Die EU-Fischereiminister haben für 2024 eine Senkung der erlaubten Fangmenge für die deutschen Fischer auf Dorsch in der westlichen Ostsee um 30 Prozent auf 73 Tonnen beschlossen. Damit darf Dorsch – der ehemalige "Brotfisch" der Ostseefischer – weiterhin nicht gezielt, sondern nur als Beifang gefischt werden. Das Gleiche gilt für den Hering, bei dem die deutsche Quote mit 435 Tonnen gegenüber dem laufenden Jahr konstant bleibt.
Beim Hering ist die Fischerei mit passiven Fanggeräten - u. a. Stellnetze und Reusen - mit Kuttern unter 12 m Länge zulässig. Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums zeigen die Bestände des Herings in der westlichen Ostsee erste Anzeichen für eine Erholung.
Auch die Freizeitangler sind von den aktuellen EU-Beschlüssen betroffen. Durften Freizeitfischer in diesem Jahr noch einen Dorsch pro Tag angeln, ist dies 2024 komplett verboten.
Die festgesetzten Fangquoten werden nach einem festen prozentualen Schlüssel als nationale Quoten auf die einzelnen EU-Mitgliedsländer aufgeteilt, die wiederum die erlaubten Fangmengen einzelnen Betrieben und Fangschiffen zuweisen. Mit ihren aktuellen Beschlüssen wollen die Fischereiminister die insgesamt zurückgegangenen Fischbestände vor allem in der westlichen Ostsee schonen.
Die Fangquoten für die deutschen Ostseefischer sind in den letzten Jahren drastisch reduziert worden. 2017 lag die deutsche Fangquote auf Hering (westliche Ostsee) noch bei 15.670 Tonnen. Das entspricht im Vergleich zur 2024er-Fangquote einem Rückgang von über 97 Prozent (vgl. auch unsere Nachricht vom 17.11.2021).
Auch die Zahl der Fischereibetriebe in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sinkt deutlich. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat deshalb im Jahr 2022 die Leitbildkommission "Zukunft der deutschen Ostseefischerei" einberufen, die ein Leitbild für eine nachhaltige und zukunftsfeste Ostseefischerei entwickeln und konkrete politische Umsetzungsmaßnahmen vorschlagen soll.
AG Ems, Tom Rüdiger und Silvia Baumgartner – das sind die drei Preisträger für exzellente Ausbildung in der Seeschifffahrt, die jetzt die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt geehrt hat. Die Preisverleihung im Rahmen des Bremer Schifffahrtskongresses zeigte die Begeisterung junger Auszubildender für die Seeschifffahrt und die enge Verbindung zwischen Deutscher Flagge und Seefahrt-Ausbildung. (11.10.2023)
Mit ihrer Auszeichnung "Exzellente Ausbildung" will die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt (BBS) auf die hohe Qualität und die besondere Attraktivität der beruflichen Ausbildung in der Seeschifffahrt aufmerksam machen. In diesem Jahr wurden geehrt:
- die Reederei AG Ems als exzellenter Ausbildungsbetrieb,
- Tom Rüdiger von der Fairplay Towage Group als exzellenter Ausbilder,
- Silvia Baumgartner von der Berufsbildenden Schule Wesermarsch als exzellente Lehrkraft.
Die Laudatoren Peter Geitmann, Malte Elsäßer sowie Marvin und Leon Goecken hoben die besondere Qualität der Schiffsmechaniker-Ausbildung hervor. Die Verbindung aus Bordpraxis und Schultheorie sowie die Kombination aus Nautik und Technik macht diese Ausbildung weltweit einzigartig.
Jörn Krüger, Direktor des Schleswig-Holsteinischen Institutes für berufliche Bildung, sicherte für das Land Schleswig-Holstein zu, auch in Zukunft Seefahrt-Ausbildungsstellen zu betreiben. Dieter Janecek, Maritimer Koordinator der Bundesregierung, hob in seiner Videobotschaft die Bedeutung der Seefahrt-Ausbildung und der Seeschifffahrt für den Standort Deutschland hervor. Dr. Iven Krämer, Leiter des Referates Hafenwirtschaft und Schifffahrt bei der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation, stellte das Social-Media Projekt "Wir machen meer" anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Schiffsmechaniker-Ausbildung vor.
Herzlichen Glückwunsch an die drei exzellenten Preisträger!

Im Rahmen des Förderprogramms "Nachhaltige Modernisierung von Küstenschiffen" hat Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing jetzt fünf Reedereien Förderbescheide über 31 Millionen Euro überreicht. Damit werden zukünftig auf 17 Schiffen umweltfreundliche Antriebe und Windassistenzsysteme eingesetzt. (10.10.2023)
Küstenschifffahrt nachhaltig und technologieoffen zu modernisieren – das ist das Ziel des Förderprogramms "Nachhaltige Modernisierung von Küstenschiffen" des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV). Mit der Förderung sollen Motoren modernisiert, Schadstoffe gemindert und die Energieeffizienz von Bestandsschiffen und Neubauten verbessert werden. Auch die Nutzung alternativer Schiffsantriebe, umweltfreundlicher Kraftstoffe wie Methanol, Ammoniak und Wasserstoff sowie der Einsatz von Windassistenzsystemen werden gefördert.
Das BMDV hat in seinem seit Anfang 2021 laufenden Förderprogramm bisher 28 Projekte mit einem Volumen von 59 Millionen Euro finanziell unterstützt. Im Rahmen des vierten Förderaufrufs überreichte jetzt Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing Förderurkunden an fünf Reedereien mit einem Gesamtvolumen von über 31 Millionen Euro. Im Einzelnen fördert das BMDV aktuell:
- den Bau von sechs mit Wasserstoff-Verbrennungsmotoren ausgerüsteten Schleppern der Reederei Fairplay Schleppdampfschiffs-Reederei Richard Borchard GmbH (Fördervolumen: 18,1 Mio. Euro; von den insgesamt 80 Schleppern der Reederei fahren 75 unter Deutscher Flagge),
- den Bau von vier umweltfreundlichen Schiffen der claus rodenberg waldkontor GmbH (Fördervolumen: 4,9 Mio. Euro; von vier Schiffen der Reederei fahren zwei unter Deutscher Flagge),
- das diesel-elektrische Antriebssystem und das Windassistenzsystem von zwei Schiffen der Fehn Ship Management GmbH (Fördervolumen: 3,1 Millionen Euro; von den zehn Schiffen der Reederei fahren sechs unter der Flagge von Lettland, drei unter Antigua+Barbuda-Flagge und eines unter Barbados-Flagge),
- die umweltfreundliche Ausrüstung von zwei Schiffen mit Hybridantrieb der Reederei Gerdes (Fördervolumen: 1,1 Mio. Euro; alle zehn Schiffe der Reederei fahren unter der Flagge von Antigua+Barbuda) und
- ein elektrisch unterstütztes Antriebssystem incl. Batterieeinheit für ein Schwergutschiff der Reederei SAL Heavy Lift (Fördervolumen: 3,6 Mio. Euro; von den 37 Schiffen der Reederei Jumbo-SAL fahren sieben unter Deutscher Flagge).
Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing betonte bei der Übergabe der Förderbescheide: "Wir setzen unsere seit 2021 erfolgreiche Unterstützung deutscher Schiffseigner auf dem Weg der Dekarbonisierung fort. Auf 17 Schiffen kommen künftig mit Hilfe unserer Förderung umweltfreundliche Antriebe sowie Windassistenzsysteme zur Reduzierung des Energieverbrauchs zum Einsatz. So minimieren wir nicht nur ganz direkt die Emissionen der Küstenschifffahrt, sondern sichern auch den Markthochlauf nachhaltiger Antriebssysteme und stärken so unsere maritime Wirtschaft in der gesamten Breite – vom Reeder bis zum Zulieferer."
Einzelheiten zu dem Förderprogramm sind in der Förderrichtlinie sowie auf der Website www.namkue.de/ zu finden.
Der Leiter der Cuxhavener Seemannsmission Martin Struwe ist jetzt für sein soziales Engagement für Seeleute mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt worden. In einer Feierstunde überreichte Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer dem Seemannsdiakon die Auszeichnung. (05.10.2023)
 „Es ist eine große Ehre, das Bundesverdienstkreuz zu erhalten. Ich sehe es auch als eine Auszeichnung für unser gesamtes Team an, denn unsere Arbeit in der Seemannsmission in Cuxhaven ist eine Teamleistung von Haupt- und Ehrenamtlichen“, so Seemannsdiakon Martin Struwe anlässlich seiner Auszeichnung, die jetzt in einer Feierstunde im Schloss Ritzebüttel stattfand.
„Es ist eine große Ehre, das Bundesverdienstkreuz zu erhalten. Ich sehe es auch als eine Auszeichnung für unser gesamtes Team an, denn unsere Arbeit in der Seemannsmission in Cuxhaven ist eine Teamleistung von Haupt- und Ehrenamtlichen“, so Seemannsdiakon Martin Struwe anlässlich seiner Auszeichnung, die jetzt in einer Feierstunde im Schloss Ritzebüttel stattfand.
Der 52-jährige leitet seit 2007 die Cuxhavener Seemannsmission. Die Hauptaufgabe von Martin Struwe und seinem Team besteht darin, Seeleute an Bord ihrer Schiffe zu besuchen. Der Grund: Die kurzen Liegezeiten vieler Schiffe lassen einen Besuch der Seeleute im Seemannsclub am Grünen Weg in Cuxhaven häufig nicht zu. Da Cuxhaven für viele Schiffe der erste deutsche Hafen in der Nordsee ist, kommen oftmals verletzte oder kranke Seeleute für ihre ärztliche Behandlung in das Cuxhavener Krankenhaus. Martin Struwe und sein Team betreuen dann diese Seeleute, in dem sie Kontakt zur Familie und Freunden herstellen, sich Sorgen und Ängste anhören, Zeitungen aus der Heimat mitbringen und bei Bedarf auch Dolmetscher organisieren.
Besonders eindrücklich ist Martin Struwe die Corona-Zeit in Erinnerung geblieben. Im Mai 2020 lag das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" in Cuxhaven. Nachdem Crew-Mitglieder an Corona erkrankten, stellte die Gesundheitsbehörde alle 3.000 Personen an Bord unter Quarantäne. Das Havariekommando Cuxhaven bat die Deutsche Seemannsmission um Unterstützung für die psychosoziale Notfallversorgung der Seeleute. „Wir haben damals in kurzer Zeit ein professionelles Team zusammengestellt“, sagt Martin Struwe. „Mitarbeitende der Seemannsmissionen aus Bremerhaven, Stade und Hamburg haben uns hier in Cuxhaven unterstützt und geholfen.“
Vor seiner Zeit in Cuxhaven war Martin Struwe in Finnland und Bremerhaven tätig. Davor studierte er an der Evangelischen Fachhochschule Berlin soziale Arbeit und absolvierte die Ausbildung zum Diakon. Martin Struwe war zwölf Jahre ehrenamtliches Vorstandsmitglied im Dachverband der Deutschen Seemannsmission. Seit 2015 ist er Fachberater des Havariekommandos in Cuxhaven für psychosoziale Notfallversorgung. Martin Struwe ist verheiratet und Vater von vier Kindern.
Am Montag hat Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, in Hamburg die "Berlin Express" getauft. Das Schiff der Reederei Hapag-Lloyd ist mit 399m Länge das größte Seeschiff der deutschen Handelsflotte. Die "Berlin Express" und ihre elf Schwesterschiffe fahren alle unter Deutscher Flagge. (4.10.2023)
Am Tag vor der Deutschen Einheit verfolgten 300 Gäste auf dem Hamburger Burchardkai die feierliche Taufe der "Berlin Express" durch Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten. Mit einer Länge von 399m, einer Breite von 61m und einer Bruttoraumzahl von 229.376 ist das neue Flaggschiff der Hamburger Traditionsreederei Hapag-Lloyd zugleich das größte Seeschiff der deutschen Handelsflotte.
Die "Berlin Express" ist das zweite Schiff der neuen "Hamburg-Express-Klasse" von Hapag-Lloyd. Die Reederei hatte Anfang 2022 eine Serie von zwölf Großcontainerschiffen in Auftrag gegeben, die bis 2025 in Fahrt kommen und im Liniendienst zwischen Asien und Europa eingesetzt werden.


Alle zwölf Schiffe der Baureihe werden unter Deutscher Flagge fahren. Rolf Habben Jansen, der Vorstandsvorsitzende der Hapag-Lloyd AG, sagt dazu: „Mit den hocheffizienten Schiffen lassen sich Emissionen sofort und sehr deutlich reduzieren. Gleichzeitig sind sie ein wichtiger Baustein unserer Strategie, die Dekarbonisierung Schritt für Schritt voranzutreiben. Alle Schiffe dieser Klasse werden unter deutscher Flagge fahren und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Schifffahrtsstandorts Deutschland.“
Die "Berlin Express" ist mit einem Duel-Fuel-Antrieb ausgestattet. Neben herkömmlichem Brennstoff kann das Schiff mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden, ist aber auch schon für den zukünftigen Einsatz nicht-fossiler Kraftstoffe wie synthetischem Gas oder E-Methan vorbereitet. Die Reederei Hapag-Lloyd hat sich zum Ziel gesetzt, ihre gesamte Schiffsflotte bis 2045 klimaneutral zu machen.


Die "Berlin Express" kann 23.664 Standard-Container laden und gehört damit zu den aktuell größten Containerschiffen der Welt. Ein kurzes Video von Hamburg Hafen Marketing über den Erstanlauf der "Berlin Express" im Hamburger Hafen zeigt die Dimensionen des 399m langen und 61m breiten Großcontainerschiffes. Das Schiff hat ein Leergewicht von 66.850 Tonnen und eine Tragfähigkeit von 224.995 Tonnen. Die "Berlin Express" verfügt über 1.500 Anschlüsse für Kühlcontainer. Die 58.270 Kilowatt der Hauptmaschine sorgen für eine Höchstgeschwindigkeit von 22 Knoten.
In einem Interview auf der Reederei-Website berichtet die 27-jährige Wachoffizierin Lara Marie Habedank, wie sie die Jungfernfahrt der "Berlin Express" von der südkoreanischen Werft nach Berlin erlebt hat und warum sie zur See fährt. Die gebürtige Brunsbüttlerin ist derzeit die einzige Frau in der 27-köpfigen Besatzung.
Am 29.09.2023 treffen sich im BSH in Hamburg Vertreterinnen und Vertreter der Wasserschutzpolizeien der Küstenbundesländer, der Staatsanwaltschaften, der BG-Verkehr, der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. (29.09.2023)
Der regelmäßige Austausch mit allen, deren Beschäftigte als Vollzugskräfte geltendes Recht in der Praxis umsetzen und kontrollieren, gewährleistet, dass dies möglichst einheitlich, effizient und effektiv geschieht.
Diesen Austausch bietet das BSH mit den regelmäßigen Vollzugskräftetreffen. Dabei stehen Fragestellungen rund um die Umsetzung von Umweltschutzvorgaben für die Seeschifffahrt auf der Agenda. Das BSH informiert dabei unter anderem über rechtliche Neuerungen. Besonders im Fokus steht dieses Jahr das Inkrafttreten der Hong-Kong-Konvention ab Mitte 2025, die nachhaltiges Schiffsrecycling fördern soll. Aber auch andere internationale Übereinkommen und deren nationale Umsetzung werden besprochen: die Durchführung von Schwefelkontrollen nach dem MARPOL-Übereinkommen (Anlage VI) und Herausforderungen beim Betrieb von Ballastwasserbehandlungsanlagen an Bord stehen ebenfalls auf dem Programm.
Weitere Informationen:
Die weltweiten Lieferketten hängen an der Schifffahrt, und die steht vor großen Herausforderungen: Dekarbonisierung bis 2050 ist das international vereinbarte Ziel. Auf der Nationalen Maritimen Konferenz wurde deutlich, dass die Industrie sehr rege nach Lösungen sucht. Die großen Aufgaben sind aktuell, Nachwuchskräfte zu gewinnen und alternative Kraftstoffe in ausreichender Menge zu erhalten. Die Bedeutung einer engen Verzahnung von Klimaschutz und Meeresforschung wird auch an dieser Stelle deutlich“, so BSH-Präsident Helge Heegewaldt. (28.09.2023)
Die maritime Wirtschaft sei die Lebensader der deutschen Gesellschaft, alles laufe über die Häfen. Waren sollen immer schneller und punktgenau bei Industrie und Endkundinnen und -kunden eintreffen. Sowohl die Corona-Pandemie als auch der Krieg zwischen Russland und Ukraine haben jedoch gezeigt, wie anfällig die Lieferketten sind, und wie abhängig wir von den Seewegen sind. Waren gelangen nur verlässlich zu Industrie und Verbrauchern, wenn die Seewege auch funktionieren.
BSH-Präsident Heegewaldt weiter: „Die Versorgungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft in Deutschland kann nur durch einen funktionierenden maritimen Sektor gewährleistet werden, das schließt auch die Energieversorgung ein. Dies ist eine gesamtdeutsche Aufgabe. Unternehmen in Süddeutschland sind genauso von den über die deutschen Seehäfen angelieferten Waren abhängig wie diejenigen in Westdeutschland und Ostdeutschland. Alle arbeiten mit per Schiff angelieferten Waren! Dessen müssen wir uns in ganz Deutschland noch stärker bewusst werden. Denn wir stehen vor großen Herausforderungen, beispielsweise im Bereich der Nachwuchsgewinnung. Gleichzeitig gilt es, die ambitionierten Ziele zum Klimaschutz umsetzen und den Sektor so für die Zukunft aufzustellen.“
50 Jahre MARPOL-Übereinkommen für eine umweltfreundlichere Schifffahrt
Der Weltschifffahrtstag der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (International Maritime Organisation – IMO) steht dieses Jahr unter dem Motto „MARPOL wird 50 – Unser Engagement geht weiter“. Das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL-Übereinkommen) vom 02.11.1973 dient dem Schutz der Meeresumwelt. Das Motto unterstreicht, wie lange die Schifffahrt bereits darum ringt, die Verschmutzung der Meere durch Schifffahrt zu verhindern. Das Ziel der IMO „Dekarbonisierung der Schifffahrt bis 2050“ unterstreicht das weiter gestiegene Umweltbewusstsein der Organisation. Weltweite Übereinkommen sind in einem global agierenden und bedeutenden Sektor wie der Schifffahrt von großer Bedeutung. Zukunftsthemen wie auch Künstliche Intelligenz können nur auf internationaler Ebene effektiv geregelt werden.
Das BSH ist zuständig für die nationale Umsetzung
Das BSH nimmt vielfältige Aufgaben im Zusammenhang mit Schifffahrt und Umwelt wahr: Es ist zuständig für die Umsetzung des MARPOL-Übereinkommens in Deutschland, also die Verhütung der Umweltverschmutzung durch Schadstoffe, Müll, Abwasser oder Schiffsabgase. Auch für die Umsetzung internationaler Abkommen zur Vermeidung der Verbreitung nicht-einheimischer Arten durch Seeschiffe im Ballastwasser oder Biofouling ist das BSH verantwortlich.
Weitere Informationen:
Ab sofort stehen die folgenden Antragsformulare auf dieser Website zur Verfügung:
Lohnnebenkostenförderung (LNK) 2024
Sie finden die Antragsformulare für die Lohnnebenkostenförderung 2024 auf der Seite Lohnnebenkosten
Der Antrag kann als elektronisches Formular über die Website online ausgefüllt werden, muss jedoch wie bisher ausgedruckt, unterschrieben und im Original beim BSH eingereicht werden.
Die Fördermittel für das nächste Jahr müssen bis zum 31. Dezember 2023 beantragt werden. Bei Antragseingang ab dem 01. Januar 2024 wird zur Ermittlung der Höhe des Zuschusses der Zeitraum bis Eingang des Antrages nicht berücksichtigt. Nach dem 30. September 2024 eingehende Anträge können nicht mehr in die Förderung einbezogen werden, da für sie die Ausschlussfrist gilt.
Sammelantrag Ausbildungsplatzförderung (APK) 2024
Sie finden den Sammelantrag auf Ausbildungsplatzförderung für Vertragsabschlüsse im Zeitraum 01.01.2024 – 31.12.2024 auf der Seite Ausbildungsplatzförderung
Bitte beachten Sie hier, dass zunächst der Sammelantrag auf Anerkennung der grundsätzlichen Förderfähigkeit gestellt und der Bescheid des BSH zum Sammelantrag abgewartet werden müssen, bevor Sie Ausbildungsverträge bzw. Heuerverträge abschließen. Anderenfalls ist eine Förderung nicht möglich.
Es wird empfohlen, im Sammelantrag eine großzügige Anzahl von Ausbildungsplätzen anzugeben. Diese Angabe verpflichtet Sie nicht dazu, diese in der angegebenen Anzahl auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen, verhindert aber ggf. einen weiteren Sammelantrag für das laufende Kalenderjahr.
Für Rückfragen und bei Problemen mit dem Ausfüllen der Formulare steht Ihnen das Team der Schifffahrtsförderung gerne zur Verfügung. Sie erreichen es unter den bekannten Telefonnummern und über das Funktionspostfach schifffahrtsfoerderung@bsh.de
Wenn über die Seeschifffahrt berichtet wird, werden meistens große Containerschiffe gezeigt. Drei Studierende aus Bremerhaven sind jetzt in ihrem Studienprojekt einen anderen Weg gegangen und haben Seeleute interviewt. Herausgekommen sind berührende Geschichten vom häufig harten Alltag auf See – und über die engagierte Arbeit der Seemannsmissionen. (25.09.2023)

Den Seeleuten eine Stimme geben und Ihnen zuhören – das ist das Ziel des Studienprojektes "Seafarers World", das die drei Studierenden Anne Güpner, Klaas Rösch und Talea Mallon jetzt in Bremerhaven realisiert haben. Das Team studiert im 4. Semester Digitale Medienproduktion an der Hochschule Bremerhaven.
Die Studierenden haben mit vielen Seeleuten gesprochen, sowohl in der Seemannsmission Bremerhaven als auch an Bord. Die Interviews mit den häufig von den Philippinen stammenden Frauen und Männern geben einen Einblick in die Alltagswelt der Seeschifffahrt. Viele Seeleute lieben ihren Beruf, aber für fast alle ist Heimweh ein großes Thema.
Die Seemannsmissionen mit ihren Clubs und Freizeitmöglichkeiten sind für Seeleute eine wichtige Anlaufstation im Hafen. Ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Seeleute zu haben, die Möglichkeit, dank W-LAN die Angehörigen zumindest auf dem Bildschirm zu sehen und einfach einmal festen Boden unter den Füßen zu spüren – das und vieles anderes macht die Arbeit der Seemannsmissionen so wertvoll.




Allein die Seemannsmission Bremerhaven empfängt jedes Jahr rund 19.000 Seeleute. Um die Arbeit der Seemannsmission Bremerhaven auch in der Öffentlichkeit bekannter zu machen, haben die drei Studierenden in ihrem Projekt auch Werbeplakate entworfen. "Seemannsmission Bremerhaven: Zuhause, fern der Heimat" lautet beispielsweise ein Plakatmotiv, das im Sommer an verschiedenen Stellen in Bremerhavens Innenstadt zu sehen war.
„Wir denken viel zu wenig an die Seeleute“, sagt Klaas Rösch. Gut, dass er und seine beiden Kommilitoninnen Anne Güpner und Talea Mallon mit ihrem Projekt den Seeleuten eine Stimme geben.
Die Interviews mit den Seeleuten und die Werbeplakate sind auf https://seafarersworld.org zu finden.
Läuft oder liegt ein Schiff quer zu den Wellen und kommt in spontanes, unkontrollierbares Aufschaukeln, ist das gefährlich. Künstliche Intelligenz soll helfen, das sogenannte parametrische Rollen vorherzusagen. Ein Projekt dazu von Dr. Sovanna Chhoeung an der Universität Oldenburg, an dem auch das BSH beteiligt war, wurde mit dem niedersächsischen Innovationspreis ausgezeichnet. (21.09.2023)
Neben der Lage zu den Wellen bedingen Schiffslänge und -form, Beladung, Tiefgang, Geschwindigkeit, Wellenhöhe und -länge ob es zum parametrischen Rollen kommt. Damit die Besatzung rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten kann, ist eine frühzeitige Warnung wichtig. Helfen soll dabei das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und Neigungsmessern, den sogenannten elektronischen Inklinometern.
Das Projekt SAiA von Dr. Sovanna Chhoeung, an dem das BSH als Partner beteiligt war, soll den Weg ebnen, für ein Assistenzsystem an Bord von Schiffen, das mittels KI parametrisches Rollen vorhersagt. Die KI ermittelt selbständig die spezifischen Daten, sodass mögliche Eingabefehler minimiert und Fehlfunktionen aufgrund von Eingabefehlern ausgeschlossen werden. Damit trägt das Projekt zu mehr Sicherheit in der Schifffahrt bei. Die Beschäftigten des BSH haben durch die Expertise im Bereich der Regularien und Sicherheitsstandards sowie durch die Validierung der Methoden für die Laborprüfung von elektronischen Inklinometern das Projekt fachlich begleitet. Ihre praktische Erfahrung in der Prüfung und Zulassung von Ausrüstungsgegenständen wie dem elektronischen Inklinometer war dabei besonders wertvoll.
Auf der 13. Nationalen Maritimen Konferenz letzte Woche in Bremen war die Deutsche Flagge gleich mehrfach Thema. Neben der Forderung nach einer einheitlichen deutschen Flaggenstaatverwaltung kam auch der enge Zusammenhang zwischen Ausbildung und Deutscher Flagge zur Sprache. Zuvor hatte der Verband Deutscher Reeder eine Garantie über 400 Ausbildungsplätze an Bord von Seeschiffen ausgesprochen. (20.09.2023)
Zwei Tage lang diskutierten rund 800 Teilnehmende in Bremen über die aktuellen Herausforderungen der maritimen Branche. Neben der Dekarbonisierung der Schifffahrt und dem Fachkräftemangel spielte auch das Thema Deutsche Flagge eine Rolle.
Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium Daniela Kluckert (FDP) betonte in ihrer Rede, dass sich die Bundesregierung zur Deutschen Flagge bekenne. Bei den Personalkosten sei die Deutsche Flagge durch die Förderung des Bundes in den letzten Jahren attraktiver geworden. Allerdings müsse die Deutsche Flagge unbürokratischer werden – dazu gehöre auch die Flaggenstaatverwaltung. Die Stärkung der Deutschen Flagge müsse jetzt im "Deutschlandtempo" erfolgen.
Anschließend stellte Reeder Rörd Braren den umweltfreundlichen Flettner-Zusatzantrieb auf seinem deutschflaggigen Seeschiff "Annika Braren" vor. Mit dem Flettner-Rotor werden erhebliche Mengen an Treibstoff und damit CO²-Emissionen eingespart.
Der neue Beauftragte für die maritime Wirtschaft der FDP-Bundestagsfraktion MdB Christian Bartelt ging ebenfalls auf das Thema Deutsche Flagge ein. Man wolle jetzt die Realisierung der einheitlichen deutschen Flaggenstaatverwaltung angehen, so der Bundestagsabgeordnete. Mit einer einheitlichen Flaggenstaatverwaltung verbinde er die Hoffnung auf mehr Seeschiffe unter Deutscher Flagge.
Auf dem Panel "Fachkräftegewinnung und -sicherung" am zweiten Konferenztag machte Konstantin Pohsin, Kapitän des deutschflaggigen Notschleppers "Nordic", den engen Zusammenhang zwischen Deutscher Flagge und seemännischer Ausbildung deutlich. Über 80% der anerkannten Ausbildungsschiffe fahren unter Deutscher Flagge, so der Nautiker.


Auch auf dem Ausbildungsforum des Verbandes Deutscher Reeder (VDR), das einen Tag vor der Nationalen Maritimen Konferenz stattfand, war die Deutsche Flagge Thema. Der Reeder Rörd Braren lobte: "Wir haben eine gute Deutsche Flagge". Holger Schwesig, Geschäftsführer der Fairplay Towage Group, hob die gute Arbeit der BG Verkehr hervor. Uwe Schmidt, SPD-Bundestagsabgeordneter, forderte mehr Zugriffsmöglichkeiten auf Tankschiffe, um die maritime Souveränität Deutschlands zu sichern. Derzeit führen nur zwei Tankschiffe unter Deutscher Flagge – das sei zu wenig, so Schmidt.
Auf dem Ausbildungsforum des VDR hatten junge Auszubildende zahlreiche Vorschläge erarbeitet, wie man mehr Aufmerksamkeit auf die Ausbildung in der Seeschifffahrt lenken könne. Die "Arbeitsaufträge" der Auszubildenden reichen dabei von verstärkter Social-Media-Nutzung und einem leicht verständlichen Überblick über alle Ausbildungsmöglichkeiten in der maritimen Branche über die persönliche Ansprache bereits an den Schulen bis hin zu mehr Aktivitäten für ein umweltfreundlicheres und nachhaltiges Image der Seeschifffahrt.
Die VDR-Präsidentin Dr. Gaby Bornheim nutzte das Ausbildungsforum für ein Signal an die zukünftigen Schifffahrts-Auszubildenden: Der VDR werde 400 seeseitige und 200 landseitige Ausbildungsplätze garantieren. Dazu passt der neue Kurzfilm des VDR, der Lust auf eine Ausbildung in der Seeschifffahrt macht – oder wie es ein Auszubildender der Reederei AG Ems treffend formuliert: "Auf See ist es einfach schön."


Der Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt (MEPC) der internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO hat vor kurzem "Vorläufige Leitlinien für die Verwendung von Biobrennstoffen im Rahmen der Regeln 26, 27 und 28 der Anlage VI von MARPOL" verabschiedet (Rundschreiben MEPC.1/Rundschreiben 905 / englische Version). Diese Vorläufigen Leitlinien helfen bei den Berechnungen für das DSC-Reporting und den Kohlenstoffintensitätsindikator (KII), wenn Biobrennstoffe an Bord von Seeschiffen verwendet werden.
Die vorläufigen Leitlinien treten am 1. Oktober 2023 in Kraft. Sie gelten bis die umfangreicheren Richtlinien bezüglich der Erfassung von Treibhausgasemissionen von der Gewinnung (Quelle) bis zum Verbrauch ("well-to-wake") entwickelt worden sind und in Kraft treten.
Das Rundschreiben MEPC.1/Rundschreiben 905 (englische Version) gilt unmittelbar für Seeschiffe unter Deutscher Flagge und kann bereits für den Überwachungszeitraum 2023 angewendet werden.
Für weitere Fragen steht Ihnen die Dienststelle Schiffssicherheit in Hamburg unter der Tel.: +49 40 36 137 217 oder per E-Mail: maschine@bg-verkehr.de gerne zur Verfügung.
In den letzten Wochen haben sich Unbekannte in E-Mails missbräuchlich als Vertreter der deutschen Hafenstaatkontrolle (PSC) ausgegeben, um anschließend mit den erlangten Daten Rechnungen an Reedereien zu verschicken. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie sich gegen solche Betrüger schützen können. (05.09.2023)
In mehreren Fällen haben sich unbekannte Täter in englischsprachigen E-mails als Vertreter der deutschen Hafenstaatkontrolle ausgegeben und Kapitäne oder Reedereien aufgefordert, Daten zum Schiff und zur Reederei mitzuteilen. Diese missbräuchlich erlangten Daten nutzen die Täter dann, unter anderem Namen der jeweiligen Reederei des Schiffes Rechnungen über nicht erbrachte Leistungen zu mailen – verbunden mit der Aufforderung, die Rechnungssumme zu überweisen. Die Täter verwendeten dabei gefälschte oder nicht existierende Namen.
Unsere Tipps, um sich vor diesen Betrugsversuchen zu schützen:
1. Reagieren Sie nicht auf E-Mails, die von folgenden E-Mail-Adressen stammen:
2. Sollten Sie öfters E-Mails von den beiden o. g. E-Mail-Adressen erhalten, markieren und blockieren Sie diese Mailadressen als Spam.
3. Prüfen Sie, ob eine E-Mail am Ende eine postalische Adresse enthält:
- wenn nicht: reagieren Sie nicht auf eine solche E-Mail.
- wenn ja, dann prüfen Sie, ob die Adresse tatsächlich mit unserer richtigen Postadresse übereinstimmt: Brandstwiete 1, 20457 Hamburg
- In den bisherigen Betrugsfällen hatten die Unbekannten die Postadressen der jeweiligen Hafenbehörden verwendet – die Hafenbehörden sind aber in Deutschland nicht für die Hafenstaatkontrolle zuständig.
4. Kommt Ihnen eine E-Mail verdächtig vor, fragen Sie sicherheitshalber bei uns nach. Unsere korrekte E-Mail-Adresse der deutschen Hafenstaatkontrolle lautet: psc-germany@bg-verkehr.de. Die Beschäftigten unserer Hafenstaatkontrolle haben E-Mail-Adressen in folgender Form: vorname.name@bg-verkehr.de. Die Namen und Kontaktdaten unserer Beschäftigten finden Sie auf unserer Website.
Leider kommen solche Betrugsversuche immer wieder vor. Im Jahr 2019 warnte zum Beispiel die US-Coastguard vor ähnlichen Betrugsversuchen. Damals verwendeten Unbekannte die gefälschte E-Mail-Adresse: port@pscgov.org, um sich Zugriff auf Schiffsrechner zu verschaffen (siehe das damalige Bulletin der US-Coastguard).
Um den Einsatz regelkonformer Schiffskraftstoffe zu überwachen, hat die EMSA gemeinsam mit dem BSH in diesem Sommer eine zweite Kampagne zur Messung von Schiffsabgasen mittels einer Drohne durchgeführt. (31.8.2023)
 Um die Messungen weit draußen auf See und in verschiedenen Schifffahrtsrouten auf der Nordsee durchführen zu können, wurde die Drohne in diesem Jahr erstmals von Bord eines Einsatzschiffes der Bundespolizei gestartet. Durchgeführt wurden die Drohnenflüge im Auftrag der europäischen maritimen Sicherheitsagentur (European Maritime Safety Agency - EMSA) durch die österreichische Firma Schiebel. Die Sensorik für die Emissionsmessungen lieferte das dänische Unternehmen Explicit.
Um die Messungen weit draußen auf See und in verschiedenen Schifffahrtsrouten auf der Nordsee durchführen zu können, wurde die Drohne in diesem Jahr erstmals von Bord eines Einsatzschiffes der Bundespolizei gestartet. Durchgeführt wurden die Drohnenflüge im Auftrag der europäischen maritimen Sicherheitsagentur (European Maritime Safety Agency - EMSA) durch die österreichische Firma Schiebel. Die Sensorik für die Emissionsmessungen lieferte das dänische Unternehmen Explicit.
Nord- und Ostsee gehören zu den am häufigsten und dichtesten befahrenen Meeren der Welt. Sehr stark frequentierte Schifffahrtsstraßen führen vom englischen Kanal in Richtung Dänemark sowie in die Elbmündung. Mit dem wachsenden Schiffsverkehr auf der Nordsee steigen auch die Emissionen von Kohlendioxid, Stickoxiden und Schwefeldioxid.
Während international nur noch Schiffkraftstoffe mit einem Schwefelgehalt von maximal 0,50 Prozent erlaubt sind, dürfen es in den Schwefelemissionskontrollgebieten (Sulphur Emission Control Area – SECA) wie Nordsee und Ostsee sogar nur 0,10 Prozent sein.
BSH und EMSA werten den diesjährigen Einsatz auf der Nordsee als Erfolg: Durch den Betrieb vom Schiff aus, konnten die Messungen flexibel auf den verschiedenen Schifffahrtsrouten der Nordsee durchgeführt werden. Das Einsatzschiff der Bundespolizei, die BP82 BAMBERG ist eins von vier großen und modernen Einsatzschiffen der so genannten POTSDAM-Klasse. Mit einem Hubschrauberlandedeck, einer vielseitig befähigten Besatzung und moderner technischer Infrastruktur an Bord, stellen die Einsatzschiffe eine hervorragende Basis für den Drohneneinsatz über der Nordsee dar. An Einsatztagen startete die Drohne zweimal täglich zu Flügen von jeweils bis zu drei Stunden. Dabei flog sie gezielt in Abgasfahnen ausgewählter Schiffe, um mittels spezifischer Sensoren Konzentration von Schwefeldioxid, Kohlendioxid und Stickoxiden zu messen. Aus dem Messergebnis kann auf Schwefelgehalt des verwendeten Kraftstoffes geschlossen werden.
Insgesamt wurden im Rahmen des Einsatzes von der BAMBERG 112 Schiffe angeflogen. Bei 54 Schiffen konnte der Schwefelgehalt im Kraftstoff mit der Drohnenmessung bestimmt werden. Dabei lag bei 6 Messungen (ca. 11 %) der ermittelte Wert über dem Grenzwert von 0,10 Prozent. Die Messkampagne endete am 28.08.2023.
Ein von der EMSA betriebenes Informationssystem stellt die Messergebnisse mit der Identität des gemessenen Schiffes den Kontrollbehörden in allen europäischen Häfen in Echtzeit zur Verfügung. Weisen die Messungen darauf hin, dass der zulässige Anteil von 0,10 Prozent Schwefel im Kraftstoff überschritten wird, können Schiffe in ihren nächsten Anlaufhäfen gezielt für gerichtsfeste Bordkontrollen ausgewählt und Proben des Kraftstoffs genommen werden. Wenn Verstöße gegen die strengen Kraftstoffvorgaben nachgewiesen werden, drohen den Verantwortlichen hohe Strafen.
Für das BSH stellt der Einsatz der EMSA-Drohne von Bord des Einsatzschiffes eine wichtige Erweiterung des BSH-Abgasmessnetzes mit Stationen in Hamburg-Wedel, Bremerhaven und Kiel dar. Im kommenden Jahr soll die Kampagne nach dem Wunsch des BSH wiederholt werden. Möglichst erneut von einem der modernen Einsatzschiffe der Bundespolizei.
Das Wilhelmshavener Unternehmen JD Offshore hat in der letzten Woche drei Offshore-Schiffe eingeflaggt und getauft. Mit den modernen Crew Transfer Vessel werden Service-Techniker in Offshore-Windparks befördert. Die Reederei plant den weiteren Ausbau ihrer Flotte. (21.07.2023)
 Offshore-Windenergie ist der aktuelle Technik-Trend und gilt als wichtige Säule zur Erreichung der Dekarbonisierungsziele. Bis zum Jahr 2030 soll die installierte Leistung von Offshore-Windenergie in Deutschland auf mindestens 30 Gigawatt und bis 2045 auf mindestens 70 Gigawatt gesteigert werden. Das noch junge Unternehmen JD Offshore GmbH aus Wilhelmshaven nutzt diese positiven Rahmenbedingungen und hat in neue Offshore-Schiffe investiert. Zusammen mit der Lübecker Reederei J. Johannsen & Sohn KG hat JD Offshore jetzt drei sogenannte Crew Transfer Vessel gekauft und unter die Deutsche Flagge gebracht. Mit Crew Transfer Vessel (CTVs) werden Service-Techniker sowie Ersatzteile zu den Offshore-Windparks befördert.
Offshore-Windenergie ist der aktuelle Technik-Trend und gilt als wichtige Säule zur Erreichung der Dekarbonisierungsziele. Bis zum Jahr 2030 soll die installierte Leistung von Offshore-Windenergie in Deutschland auf mindestens 30 Gigawatt und bis 2045 auf mindestens 70 Gigawatt gesteigert werden. Das noch junge Unternehmen JD Offshore GmbH aus Wilhelmshaven nutzt diese positiven Rahmenbedingungen und hat in neue Offshore-Schiffe investiert. Zusammen mit der Lübecker Reederei J. Johannsen & Sohn KG hat JD Offshore jetzt drei sogenannte Crew Transfer Vessel gekauft und unter die Deutsche Flagge gebracht. Mit Crew Transfer Vessel (CTVs) werden Service-Techniker sowie Ersatzteile zu den Offshore-Windparks befördert.
In einem kleinen Festakt tauften Vertreterinnen der Reedereien JD Offshore und J. Johannsen die drei CTVs in Wilhelmshaven auf folgende Namen:
• "JD One" (ex "Dalby Ouse"), 26,50 m lang, 126 BRZ, 2016 gebaut,
• "JD Eagle" (ex "Dalby Aire"), 22,40 m lang, 44 BRZ, 2013 gebaut,
• "JD Express" (ex "Dalby Swale"), 21,70 m lang, 40 BRZ, 2014 gebaut.
 Eigentümerin der drei Schiffe ist die J. Johannsen & Sohn KG, der Betreiber der Schiffe die JD Offshore GmbH. Die JD Offshore GmbH ist eine Tochterfirma der Jade-Dienst GmbH, deren Hauptgesellschafter das Festmacher-Unternehmen Hamburg Lines Men GmbH und die Lübecker Johannsen & Sohn KG ist. Nach Firmenangaben ist die JD Offshore GmbH nicht nur Reederei, sondern wird auch logistische und Hafendienste anbieten. Das Unternehmen sieht in dem beschlossenen weiteren Ausbau der Offshore-Windenergie ein attraktives Marktumfeld.
Eigentümerin der drei Schiffe ist die J. Johannsen & Sohn KG, der Betreiber der Schiffe die JD Offshore GmbH. Die JD Offshore GmbH ist eine Tochterfirma der Jade-Dienst GmbH, deren Hauptgesellschafter das Festmacher-Unternehmen Hamburg Lines Men GmbH und die Lübecker Johannsen & Sohn KG ist. Nach Firmenangaben ist die JD Offshore GmbH nicht nur Reederei, sondern wird auch logistische und Hafendienste anbieten. Das Unternehmen sieht in dem beschlossenen weiteren Ausbau der Offshore-Windenergie ein attraktives Marktumfeld.
Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat vergangene Woche neue Richtlinien verabschiedet, um den Bewuchs von Schiffen (sog. Biofouling) zu kontrollieren. So kann die Ausbreitung von invasiven Arten verringert werden. Das BSH organisiert am 12. Oktober 2023 einen Runden Tisch in Hamburg, um die Umsetzung der Richtlinien zu unterstützen. (13.07.2023)
Alle untergetauchten Oberflächen, zum Beispiel Schiffsrümpfe, werden von Organismen, wie Mikroben, Algen oder Muscheln, besiedelt. Dieser Bewuchs wird auch als Biofouling bezeichnet. So können Arten an Orte gelangen, wo sie natürlicherweise nicht vorkommen und wo sie sich unter Umständen ansiedeln und ausbreiten können. Dies kann eine Gefahr für den Menschen und die Umwelt darstellen.
„Ein sauberer Schiffsrumpf kann dazu beitragen, die biologische Vielfalt der Meere zu schützen. Darüber hinaus verbrauchen Schiffe so weniger Treibstoff und stoßen weniger Abgase aus“, erklärt BSH-Präsident Helge Heegewaldt. „Die neuen Biofouling-Richtlinien sind daher ein Gewinn für Mensch und Umwelt.“
Neue Richtlinien helfen beim Umgang mit Biofouling
Die Richtlinien wurden erstmals 2011 verabschiedet und bieten einen einheitlichen Ansatz für das Management von Biofouling. Um die Akzeptanz zu erhöhen, wurden sie nun weitestgehend überarbeitet. Die Richtlinien sind nach wie vor unverbindlich.
Sie empfehlen praktische Maßnahmen, wie die Risiken von Biofouling minimiert werden können. Unter anderem unterstützen sie dabei, einen Biofouling-Management-Plan zu entwickeln, geeignete Antifouling-Systeme zu verwenden, den Bewuchs regelmäßig zu begutachten und Schiffsrümpfe bestmöglich unter Wasser zu reinigen.
Darüber hinaus sollen demnächst IMO-Leitlinien zur Unterwasser-Reinigung entwickelt werden. Dafür können Mitgliedsstaaten bewährte Verfahren zur Inspektion und Reinigung von Biofouling bei der IMO einreichen.
Runder Tisch „Biofouling“ unterstützt die Umsetzung der Richtlinien
Seit 2019 veranstaltet das BSH zusammen mit dem Verband Deutscher Reeder (VDR) erfolgreich einen Runden Tisch „Biofouling“ mit verschiedenen Interessensgruppen. Die Erfahrungen und der Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Überarbeitungsprozess der Richtlinien unterstützt.
Der nächste Runde Tisch findet am 12. Oktober 2023 in Hamburg statt. Bei dem Treffen werden unter anderem die überarbeiteten Richtlinien und mögliche Herausforderungen bei der Umsetzung thematisiert.
Internationales Projekt GloFouling läuft noch bis Ende 2023
Das BSH ist ein strategischer Partner des IMO-Projekts GloFouling. Ziel ist es, die Umsetzung der IMO-Richtlinien zu unterstützen sowie bestmögliche Praktiken und einheitliche Standards für das Management von Biofouling zu entwickeln. So beteiligt sich das BSH aktiv an den Prozessen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene. Denn nur gemeinsam kann die Verbreitung von invasiven Arten minimiert werden.
Weitere Informationen:
- zum Thema Biofouling und den IMO-Richtlinien
- zum Runden Tisch von BSH und VDR
- zum Erklärvideo „Biofouling“ des BMDV-Expertennetzwerkes
Kontakt:
Sina Bold
Wissenschaftskommunikation (BSH)
Tel.: 040/3190-3501
sina.bold@bsh.de
Dr. Nicole Heibeck
Nachhaltigkeit im Schiffsverkehr (BSH)
Tel: 040/3190-7613
nicole.heibeck@bsh.de
Dr. Jörg Abel ist seit dem 1. Juli neuer Leiter des Seeärztlichen Dienstes der BG Verkehr. Er folgt auf Dr. Philipp Langenbuch, der nach 26 verdienstreichen Jahren beim Seeärztlichen Dienst in den Ruhestand gegangen ist. (12.07.2023)
 Der Seeärztliche Dienst (SÄD) ist im Auftrag des Bundes für die Sicherheit und die medizinische Versorgung der Besatzungsmitglieder auf Seeschiffen verantwortlich. Was so rasch dahingesagt ist, umfasst ein breites Spektrum an Zuständigkeiten, angefangen von den Seediensttauglichkeitsuntersuchungen über die medizinische Ausstattung an Bord bis hin zu den medizinischen Wiederholungslehrgängen von Nautikern oder die Fachaufsicht über die funkärztliche Beratung.
Der Seeärztliche Dienst (SÄD) ist im Auftrag des Bundes für die Sicherheit und die medizinische Versorgung der Besatzungsmitglieder auf Seeschiffen verantwortlich. Was so rasch dahingesagt ist, umfasst ein breites Spektrum an Zuständigkeiten, angefangen von den Seediensttauglichkeitsuntersuchungen über die medizinische Ausstattung an Bord bis hin zu den medizinischen Wiederholungslehrgängen von Nautikern oder die Fachaufsicht über die funkärztliche Beratung.
So vielseitig die Aufgaben des SÄD, so anspruchsvoll die Anforderungen an dessen Leitung. Neben umfangreichem Fach- und Praxiswissen ist es wichtig, auch die Arbeitsbedingungen an Bord aus eigener Erfahrung zu kennen. So wie Dr. Jörg Abel. Nach seinem Studium der Humanmedizin in Hamburg ließ er sich zum Facharzt für Anästhesie weiterbilden und legte 2006 erfolgreich die Facharztprüfung ab. Als Anästhesist und Intensivmediziner arbeitete er unter anderem für die Bundeswehrkrankenhäuser in Ulm und Hamburg sowie als Marine-Arzt auf See, anschließend mehrere Jahre als Oberarzt in der Notaufnahme der Elbeklinik Buxtehude. Im August 2015 heuerte Dr. Jörg Abel beim Seeärztlichen Dienst der BG Verkehr an und übernahm die stellvertretende Leitung.
Schwerpunktmäßig kümmerte er sich in dieser Funktion um den großen Bereich der Seelotseignung. „Dieser Bereich hat sich seit Ende 2022 durch die neue Seelotseignungsverordnung und die Übernahme der psychologischen Eignungstests durch den Seeärztlichen Dienst deutlich vergrößert", erzählt Dr. Jörg Abel. „Wir haben da sehr arbeitsintensive Monate hinter uns."
Und die nächste große Baustelle wartet schon: Unter anderem arbeitet der Seeärztliche Dienst seit Anfang des Jahres gemeinsam mit der Bundesärztekammer an einer kurrikulären Fortbildung für Maritime Medizin. „Die umfangreiche freiwillige Bildungsmaßnahme soll Ärztinnen und Ärzten einen fundierten Überblick über alle Themenbereiche der Maritimen Medizin geben. Dazu gehören zum Beispiel die Bereiche Seediensttauglichkeit, Schiffsärzte, Taucher, Marine oder Offshore", erklärt Dr. Jörg Abel. „Bisher gibt es hier nur Vorschläge einzelner Anbieter zu Teilgebieten. Der SÄD als die zuständige Aufsichtsbehörde hat das nun kanalisiert."
Ein weiterer wichtiger Punkt auf der To-Do-Liste des SÄD-Leiters: Das Medizinische Handbuch See soll digitalisiert und als App zur Verfügung gestellt werden. „Und zwar auf vielfachen Wunsch von Seeleuten“, sagt Dr. Jörg Abel. Das Medizinische Handbuch See ist eines der zahlreichen Erfolgsprojekte seines Vorgängers Dr. Philipp Langenbuch.
Doch nicht nur in die nationale, auch in die internationale Projektarbeit ist Dr. Jörg Abel stark eingebunden. So wird er künftig noch öfter als bisher für den SÄD als Vertreter Deutschlands an internationalen Gremien und Konferenzen teilnehmen - etwa im Oktober beim International Symposium on Maritime Health (ISMH) in Athen oder kurz darauf auf einer ILO-Sitzung über die medizinische Untersuchung von Fischern.
Neben seiner Arbeit beim SÄD fährt Dr. Jörg Abel weiterhin einen Tag pro Monat als Notarzt im Rettungsdienst, wie schon in den vergangenen Jahren. Leben retten, wenn es hart auf hart kommt: Dafür ist er schließlich Arzt geworden. Die Sicherheit und medizinische Versorgung von Seeleuten werden beim Seeärztlichen Dienst der BG Verkehr auch künftig in besten Händen sein.
Alle 175 Mitgliedsstaaten der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO haben sich auf der 80. Tagung des Meeresumwelt-Ausschusses (MEPC) auf eine aktualisierte Strategie zur Verringerung der Treibhausgase von Seeschiffen geeinigt. Das Ziel: Bis 2050 soll die Seeschifffahrt klimaneutral werden. (11.07.2023)
 Der Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt (MEPC) der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO hat auf seiner 80. Tagung in London mit den Stimmen aller 175 Mitgliedsstaaten eine gemeinsame Strategie für die schrittweise Reduzierung der Treibhausgase durch Schiffe vereinbart. Das Ziel: eine komplett treibhausgasfreie internationale Seeschifffahrt im Jahr 2050.
Der Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt (MEPC) der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO hat auf seiner 80. Tagung in London mit den Stimmen aller 175 Mitgliedsstaaten eine gemeinsame Strategie für die schrittweise Reduzierung der Treibhausgase durch Schiffe vereinbart. Das Ziel: eine komplett treibhausgasfreie internationale Seeschifffahrt im Jahr 2050.
 Der Weg zur Klimaneutralität soll in mehreren Schritten erfolgen. Die IMO-Mitgliedstaaten vereinbarten als Zwischenziele die Reduzierung der Treibhausgase aus der internationalen Schifffahrt um 20 bis 30% bis zum Jahr 2030 und um 70 bis 80% bis zum Jahr 2040 (jeweils im Vergleich zu 2008). Der Ausstoß von CO2 soll bis zum Jahr 2030 um 40% reduziert werden. Die schrittweise Umsetzung der Reduzierung der Treibhausgase in der Seeschifffahrt orientiert sich am 1,5-Grad-Temperaturziel des Pariser Klimaschutzabkommens.
Der Weg zur Klimaneutralität soll in mehreren Schritten erfolgen. Die IMO-Mitgliedstaaten vereinbarten als Zwischenziele die Reduzierung der Treibhausgase aus der internationalen Schifffahrt um 20 bis 30% bis zum Jahr 2030 und um 70 bis 80% bis zum Jahr 2040 (jeweils im Vergleich zu 2008). Der Ausstoß von CO2 soll bis zum Jahr 2030 um 40% reduziert werden. Die schrittweise Umsetzung der Reduzierung der Treibhausgase in der Seeschifffahrt orientiert sich am 1,5-Grad-Temperaturziel des Pariser Klimaschutzabkommens.
Die IMO wird spätestens im Jahr 2025 ein Maßnahmenpaket verabschieden, um die vereinbarten Ziele erreichen zu können. Dazu gehören konkrete Vorgaben zur Verwendung verschiedener Brennstoffe und zum Einsatz alternativer Antriebsarten von Seeschiffen. Für neue Seeschiffe sollen die bereits bestehenden Energieeffizienz-Vorgaben der IMO verschärft werden. Außerdem wird die IMO ein Emissionshandelssystem einführen, um wirtschaftliche Anreize zur Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen durch Seeschiffe zu schaffen.
 Der Generalsekretär der IMO Kitack Lim erklärte auf der Sitzung des Meeresumweltschutz-Ausschusses, es sei seiner Organisation besonders wichtig, dass die Strategie von allen Mitgliedsstaaten gemeinsam zu schultern sei. Wirtschaftlich schwächere Nationen sowie Entwicklungsländer und kleine Inselnationen dürften nicht durch die ambitionierte Umweltpolitik von den großen Industrienationen abgehängt werden. Mögliche Ungleichgewichte sollen durch eine umfassende finanzielle Förderung abgemildert werden.
Der Generalsekretär der IMO Kitack Lim erklärte auf der Sitzung des Meeresumweltschutz-Ausschusses, es sei seiner Organisation besonders wichtig, dass die Strategie von allen Mitgliedsstaaten gemeinsam zu schultern sei. Wirtschaftlich schwächere Nationen sowie Entwicklungsländer und kleine Inselnationen dürften nicht durch die ambitionierte Umweltpolitik von den großen Industrienationen abgehängt werden. Mögliche Ungleichgewichte sollen durch eine umfassende finanzielle Förderung abgemildert werden.
Der Meeresumweltausschuss der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), der vom 3. bis 7. Juli 2023 in London tagte, hat neue Richtlinien verabschiedet, um den schifffahrtsbedingten Unterwasserlärm zu verringern. Das BSH war an dem Prozess aktiv beteiligt. Die Richtlinien sind ein wichtiges Signal für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere. (10.7.2023)
Die Schifffahrt ist eine der Hauptquellen für dauerhaften Unterwasserlärm, der negative Auswirkungen auf das Leben im Meer haben kann. Er kann beispielsweise die Kommunikation von Meeressäugern einschränken, deren Hörsinn vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen und sie aus ihrem Lebensraum vertreiben.
„Im Sinne eines nachhaltigen Meeresschutzes ist es wichtig, gemeinsam internationale Richtlinien und regionale Aktionspläne zu entwickeln sowie den Unterwasserlärm grenzüberschreitend zu überwachen. Daher begrüße ich die neuen Richtlinien zur Verringerung des Unterwasserlärms sehr“, erklärt BSH-Präsident Helge Heegewaldt.
Neue Richtlinien bieten Überblick und Vorlagen für Schiffsbetreiber
Die Richtlinien fassen den aktuellen Stand des Wissens zusammen und geben einen Überblick über technische und operative Maßnahmen, wie der Unterwasserlärm von Schiffen reduziert werden kann. So helfen sie Konstrukteuren, Schiffsbetreibern und Verwaltungen, entsprechende Maßnahmen zu entwickeln und mögliche Auswirkungen auf die Energieeffizienz der Schiffe zu bewerten.
Sie verweisen auf internationale Messstandards, Empfehlungen und Regeln. Außerdem enthalten sie Mustervorlagen, die Schiffseignern dabei helfen, einen Unterwasserlärm-Managementplan zu erstellen. Die neuen Richtlinien ersetzen die bisherigen aus dem Jahr 2014. Sie sind nach wie vor unverbindlich.
Weniger Unterwasserlärm für die Meeresumwelt
Die internationalen Richtlinien können dazu beitragen, den Zustand der Meere zu verbessern. Im Jahr 2022 hat die Europäische Union wiederum erstmals gemeinsame Grenzwerte für Unterwasserlärm festgelegt. Wie diese Grenzwerte konkretisiert werden können, wird derzeit im Rahmen der regionalen Übereinkommen zum Schutz des Nordostatlantiks (OSPAR) und der Ostsee (HELCOM) diskutiert. Das BSH beteiligt sich aktiv an den Prozessen auf internationaler, europäischer und regionaler Ebene, um den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere zu fördern.
Das BSH misst kontinuierlich den Unterwasserlärm an den beiden Stationen „Fehmarnbelt“ und „Arkona“ entlang bedeutender Schifffahrtsrouten in der Ostsee:
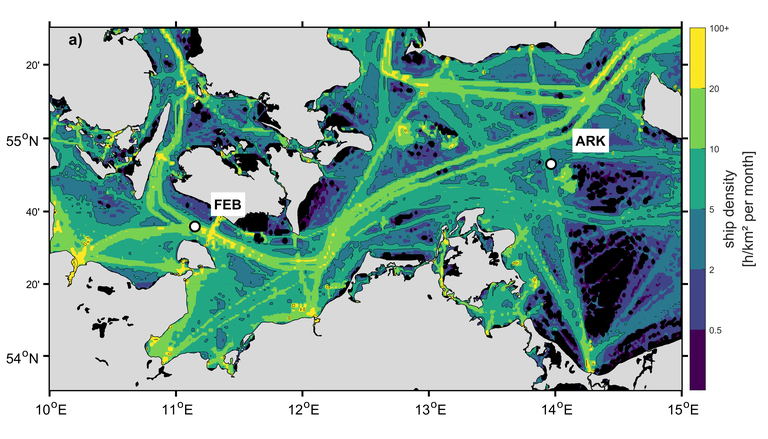
Weitere Informationen:
- zum Thema Unterwasserlärm von der IMO (in Englisch)
- zum nationalen Schallregister, das vom BSH betrieben wird
Kontakt:
- Sina Bold | Wissenschaftskommunikation | BSH | 040 3190-3501 | sina.bold@bsh.de
- Dr. Susanne Heitmüller & Dr. Nicole Heibeck | Nachhaltigkeit im Schiffsverkehr | BSH | 040 3190-7611 bzw. -7613 | susanne.heitmueller@bsh.de | nicole.heibeck@bsh.de
Nachdem zuletzt Bangladesch und Liberia das Internationale Übereinkommen über das sichere und umweltgerechte Recycling von Schiffen ratifiziert haben, wird die Konvention in zwei Jahren in Kraft treten. Das Hong-Kong-Übereinkommen setzt verbindliche Standards für das Abwracken von Seeschiffen und das Recyceln der an Bord verwendeten Werkstoffe. (6.7.2023)

Über 15 Jahre nach seiner Verabschiedung wird das Internationale Übereinkommen über das sichere und umweltgerechte Recycling von Schiffen (Hong-Kong-Übereinkommen) am 26. Juni 2025 in Kraft treten. Mit dem kürzlich erfolgten Beitreten von Bangladesch als Standort vieler Abwrackwerften und Liberia als großem Flaggenstaat zum Hong-Kong-Übereinkommen ist der für das Inkrafttreten nötige Anteil von 40 % der Welthandelstonnage erreicht. Deutschland ratifizierte das Hong Kong Übereinkommen im Juli 2019 (auf dem Foto ist das Überreichen der deutschen Ratifikationsurkunde an den IMO-Generalsekretär zu sehen).
In Abwrackländern wie Bangladesch und Indien ist das sogenannte "Beaching" nach wie vor weit verbreitet. Bei dieser Methode werden Seeschiffe mit hoher Geschwindigkeit auf einen Strandabschnitt gefahren und dort von Arbeitern per Hand zerlegt - zumeist ohne Beachtung von Umweltschutz-, Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsstandards.
 Die EU hat bereits 2019 einige der Regelungen des Hong-Kong-Übereinkommens für ihre Mitgliedsstaaten verbindlich gemacht. Durch die Verordnung EU 1257/2013 über das Recycling von Schiffen ist das Gefahrstoffinventar (Inventory of Hazardous Materials, IHM) auf Schiffen, die unter der Flagge eines EU-Landes fahren, ein verpflichtender Bestandteil der Schiffsdokumentation.
Die EU hat bereits 2019 einige der Regelungen des Hong-Kong-Übereinkommens für ihre Mitgliedsstaaten verbindlich gemacht. Durch die Verordnung EU 1257/2013 über das Recycling von Schiffen ist das Gefahrstoffinventar (Inventory of Hazardous Materials, IHM) auf Schiffen, die unter der Flagge eines EU-Landes fahren, ein verpflichtender Bestandteil der Schiffsdokumentation.
Bisher haben sich nur wenige Recyclingwerften außerhalb Europas nach der EU-Verordnung zertifizieren lassen. Das führt in vielen Fällen dazu, dass abzuwrackende Schiffe an Reedereien ins außereuropäische Ausland verkauft werden, die Schiffe unter Nicht-EU-Flaggen wechseln und dann vor allem in Südasien abgewrackt werden.
Die Verabschiedung des Hong-Kong-Übereinkommens im Jahr 2009 sowie der EU-Recycling-Verordnung haben allerdings zu einem Bewusstseinswandel beigetragen. Viele der international bedeutenden Recyclingwerften in Indien und Bangladesch passen derzeit ihre Abwrackpraktiken an die Vorgaben des Hong-Kong-Übereinkommens an. Das kommt gerade zur rechten Zeit, denn der Schifffahrtsverband BIMCO schätzt, dass in den nächsten zehn Jahren circa 15.000 Seeschiffe abgewrackt und recycelt werden müssen.
Wie bekommt man bei einer Havarie eines Schiffes hundert Gäste und die Besatzung schnell und sicher von Bord? Das NDR-Fernsehen hat jetzt eine Evakuierungsübung auf dem ehemaligen Feuerschiff "Amrumbank" im Emder Hafen gefilmt. Das Notfalltraining ist eine Voraussetzung für das Sicherheitszeugnis, das Betreiber von Traditionsschiffen benötigen. (5.7.2023)
 Auch auf Traditionsschiffen gehören Notfall- und Evakuierungsübungen zum Pflichtprogramm, da Gäste an Bord solcher Schiffe genauso einen Anspruch auf Sicherheit haben wie auf gewerblichen Fahrgastschiffen. Das NDR-Fernsehen hat jetzt eine solche Evakuierungsübung auf dem ehemaligen Feuerschiff "Amrumbank" im Emder Innenhafen begleitet und gefilmt. Die ehrenamtliche Besatzung des Museumsschiffs hatte über hundert Freiwillige organisiert, die das Notfallszenario einer Kollision mit einem anderen Schiff und das Verlassen des Traditionsschiffs übten. Simuliert wurde auch die Kopfverletzung eines Besatzungsmitglieds und dessen Behandlung durch Schiffsarzt Rolf de Vries sowie die anschließende Abbergung von Bord.
Auch auf Traditionsschiffen gehören Notfall- und Evakuierungsübungen zum Pflichtprogramm, da Gäste an Bord solcher Schiffe genauso einen Anspruch auf Sicherheit haben wie auf gewerblichen Fahrgastschiffen. Das NDR-Fernsehen hat jetzt eine solche Evakuierungsübung auf dem ehemaligen Feuerschiff "Amrumbank" im Emder Innenhafen begleitet und gefilmt. Die ehrenamtliche Besatzung des Museumsschiffs hatte über hundert Freiwillige organisiert, die das Notfallszenario einer Kollision mit einem anderen Schiff und das Verlassen des Traditionsschiffs übten. Simuliert wurde auch die Kopfverletzung eines Besatzungsmitglieds und dessen Behandlung durch Schiffsarzt Rolf de Vries sowie die anschließende Abbergung von Bord.
Mit dabei waren zwei Besichtiger der Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Übung beobachteten und protokollierten. Die Notfallübung ist eine von vielen Sicherheitsmaßnahmen, die für das Sicherheitszeugnis als Traditionsschiff erforderlich sind.
In dem gut dreiminütigen TV-Beitrag der NDR-Regionalsendung "Hallo Niedersachsen" kommen auch mehrere ehrenamtliche Besatzungsmitglieder der "Amrumbank" zu Wort, darunter Kapitän Gerhard Janßen, im Hauptberuf Seelotse und Ältermann der Lotsenbrüderschaft Emden.
Die Evakuierungsübung verlief erfolgreich: Statt der vorgeschriebenen 30 Minuten benötigten die insgesamt 125 Personen nur 20 Minuten für das Verlassen des Feuerschiffs.
Der NDR hat seinen TV-Beitrag in zwei Versionen veröffentlicht:
- TV-Beitrag in der NDR-Sendung "Hallo Niedersachsen" (3min.)
- Kürzere Version des TV-Beitrags auf der NDR-Website (1:30min.)
Das Feuerschiff "Amrumbank" wurde 1917 in Dienst gestellt. Von 1919 bis 1939 lag das Feuerschiff vor der Westküste Schleswig-Holsteins bei der Untiefe "Amrum-Bank", später dann auf der Seeposition "Deutsche Bucht" westlich von Helgoland. Weitere Informationen zum Schiff und seine Geschichte bietet die Website des Betreibervereins.
Das BSH hat vom 28.-30.06.2023 Vertreterinnen und Vertreter der Wasserschutzpolizeien der Küstenländer und Hafenbehörden in einem Workshop zur Beprobung von Schiffskraftstoffen und der Kontrolle von Schiffen mit Abgasreinigungssystemen (sog. Scrubbern) versammelt. (30.6.2023)
Helge Heegewaldt, Präsident des BSH, erklärt dazu: „Wir brauchen länderübergreifend einheitliche Kontrollen. Deshalb freuen wir uns, die Kolleginnen und Kollegen der Wasserschutzpolizeien zusammengebracht und einheitliche Vorgehensweisen diskutiert zu haben. Nur so kommen am Ende auch vergleichbare Ergebnisse heraus.“
Der umfassende Austausch zwischen dem BSH und den Vertreterinnen und Vertretern der Wasserschutzpolizeien im Rahmen des Workshops ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einheitlichen Kontrollen und Probenahmen bei Luftverschmutzungen durch Seeschiffe.
Im Rahmen des Workshops wurde den Vollzugskräften eine länderübergreifend einheitliche Verfahrensweise zur Beprobung von Schiffskraftstoffen vermittelt, die den Standards der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) und der EU-Vorgaben entspricht. Hierzu stellte das BSH den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entsprechendes Probenahme-Material zur Verfügung.
Darüber hinaus diskutierte die Runde anhand von Fallbeispielen den Einsatz unterschiedlicher Scrubbertechnologien und damit einhergehende Besonderheiten bei der Ermittlung etwaiger Verstöße. Hierbei ging es auch um den Austausch von Erfahrungen aus Scrubberkontrollen in benachbarten Ländern.
Kraftstoffe, die an Bord von Schiffen verwendet werden, dürfen gemäß Vorgaben der IMO bestimmte Schwefelgrenzwerte nicht überschreiten. In Emissionsüberwachungsgebieten wie der Nordsee und Ostsee und in den Häfen ist ein besonders strenger Grenzwert von maximal 0,10 Prozent Schwefelgehalt festgeschrieben.
Schwefelgrenzwerte können sowohl durch das Verwenden entsprechend niedrigschwefliger Schiffskraftstoffe als auch durch den Einsatz von Scrubbern eingehalten werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.bsh.de.
Die neue Bremer Regierungskoalition will Maßnahmen zur Stärkung der Deutschen Flagge vorantreiben. Das hat das zukünftige Bündnis in seinem jetzt vorgestellten Koalitionsvertrag festgelegt. Zudem wollen SPD, Grüne und Linke die Bremischen Häfen klimafreundlich umbauen, das Schiffsrecycling im Land Bremen unterstützen und den Wandel der Seeschifffahrt aktiv gestalten. (27.6.2023)
 Rund sechs Wochen nach der Bürgerschaftswahl stellten Vertreterinnen und Vertreter der neuen Bremer Regierungskoalition jetzt ihren Koalitionsvertrag unter dem Titel "Veränderung gestalten: sicher, sozial, ökologisch, zukunftsfest" vor. Auf knapp 170 Seiten werden die politischen Ziele von Rot-Grün-Rot in Bremen für die 21. Wahlperiode beschrieben.
Rund sechs Wochen nach der Bürgerschaftswahl stellten Vertreterinnen und Vertreter der neuen Bremer Regierungskoalition jetzt ihren Koalitionsvertrag unter dem Titel "Veränderung gestalten: sicher, sozial, ökologisch, zukunftsfest" vor. Auf knapp 170 Seiten werden die politischen Ziele von Rot-Grün-Rot in Bremen für die 21. Wahlperiode beschrieben.
Die Bremer Koalition setzt sich für die Stärkung der Deutschen Flagge ein. Wörtlich heißt es im Koalitionsvertrag: "Gestützt auf unsere Verantwortung für die bremischen Häfen und den interfraktionellen Beschluss der Bremischen Bürgerschaft zur Nationalen Hafenstrategie werden wir uns aktiv in die Gestaltung der nationalen wie europäischen Hafen- und Schifffahrtspolitik einbringen sowie Maßnahmen zur Stärkung des Schifffahrtsstandortes Deutschland und der Deutschen Flagge vorantreiben." Bereits der Vorgänger-Senat hatte sich dafür eingesetzt, dass Bremer Reedereien wieder vermehrt unter deutscher Flagge fahren.
Breiten Raum im Koalitionsvertrag nimmt das Kapitel "Häfen" ein. Neben der Umsetzung konkret benannter Infrastrukturprojekte in Bremen und Bremerhaven geht es dabei um die Planung eines "Energy Port", die Nutzung erneuerbarer Energien im Hafen ("Green Ports", "Klimaneutraler Überseehafen", Ausbau der Landstromanschlüsse) sowie um die Vertiefung der Außenweser für Seeschiffe. Die Koalition will den Werftenstandort Bremerhaven stärken und neue Chancen nutzen, "die sich im Bereich Schiffbau, dem Ausbau der Erneuerbaren Energien und dem nachhaltigen Schiffsrecycling ergeben." Dazu sollen die konkreten Potentiale zur Wertschöpfung, Wiederverwertung und Emissionsreduktion des Recyclings von Schiffen im Land Bremen ermittelt werden und mögliche Standorte für investitionsbereite Unternehmen geprüft werden.
Zudem soll der "tiefgreifende Wandel der Schifffahrtsbranche" aktiv gestaltet und "Initiativen zur Förderung einer autonomen Schifffahrt" unterstützt werden. Die Leistungsfähigkeit des Havariekommandos soll an die neuen Herausforderungen zunehmender Verkehre und den massiven Aufbau von Windparks in Nord- und Ostsee angepasst werden.
Die Bremer Regierungskoalition will außerdem die finanzielle Unterstützung der Seenotrettung im Mittelmeer durch eine Patenschaft prüfen.
Aus dem Koalitionsvertrag ergibt sich auch die Ressortverteilung im neuen Bremer Senat. Der Bereich Häfen wird zukünftig im erweiterten Ressort "Wirtschaft und Häfen" angesiedelt sein, für welche die Partei Die Linke Verantwortung tragen wird. Laut Pressemeldungen soll die bisherige Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Die Linke) das Ressort "Wirtschaft und Häfen" übernehmen.
Die Parteitage der drei an der Regierung beteiligten Parteien müssen dem Koalitionsvertrag noch zustimmen.
Im März endete eine fünfjährige Übergangsfrist in der Schiffssicherheitsverordnung. Seitdem müssen sich Besatzungsmitglieder, die zur sicheren Schiffsbesatzung von Traditionsschiffen gehören, verpflichtend auf ihre Seediensttauglichkeit untersuchen lassen. Die BG Verkehr hat jetzt die wichtigsten Informationen dazu zusammengefasst. (26.6.2023)
Bereits 2018 hatte das Bundesverkehrsministerium entschieden, dass sich Besatzungsmitglieder, die zur sicheren Schiffsbesatzung von Traditionsschiffen gehören, genau wie Berufs-Seeleute alle zwei Jahre auf ihre Seediensttauglichkeit hin untersuchen lassen müssen. Ein Grund dafür ist, dass auf Traditionsschiffen häufig viele Gäste an Bord mitfahren und Traditionsschiffe in der Regel in dicht befahrenen und navigatorisch anspruchsvollen Küstengewässern unterwegs sind. Die fünfjährige Übergangsfrist, in der man die Untersuchungen freiwillig machen konnte, ist am 14. März 2023 ausgelaufen. Seitdem sind die Seediensttauglichkeits-Untersuchungen verpflichtend.
Die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr hat jetzt alle wichtigen Details in ihrer Information "Seediensttauglichkeit für Besatzungsmitglieder von Traditionsschiffen" zusammengefasst. Wer genau muss sich untersuchen lassen, welche gesundheitlichen Vorgaben gibt es, wer untersucht und wieviel kosten die Untersuchungen? Die jetzt erschienene Information der BG Verkehr beantwortet diese Fragen.
Weitere Informationen zur Seediensttauglichkeit und zum Ablauf der Untersuchungen bietet die Dienststelle Schiffssicherheit auf ihrer Website unter: www.deutsche-flagge.de/de/maritime-medizin/seediensttauglichkeit
Anlässlich des "Internationalen Tags der Seeleute" fordert der Präsident des BSH, Helge Heegewaldt, eine bessere Einhaltung internationaler Übereinkommen zum Schutz der Meere und mehr Aufklärung über die Bedeutung der Meere. Der diesjährige „Internationale Tag des Seefahrers“ steht unter dem Motto "MARPOL mit 50 Jahren - Unser Engagement geht weiter". (24.6.2023)
Heegewaldt betont die Bedeutung der Seeleute für die Einhaltung von Übereinkommen zum Meeresumweltschutz: „Die Schiffsbesatzungen setzen tagtäglich durch Müll- und Abwassermanagement auf den Schiffen die Vorschriften aus internationalen Übereinkommen zum Schutz der Meere um – darunter auch das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe MARPOL, das am 2. November 2023 50 Jahre alt wird.“
Angesichts der Ergebnisse der bundesweiten Aktionstage Gewässer- und Umweltschutz (BAGU) im Juni 2023 sieht Heegewaldt allerdings Verbesserungsbedarf: „Die Wasserschutzpolizeien beanstandeten bei 2293 Kontrollen 691 Regelwidrigkeiten von Schiffen und anderen Wasserfahrzeugen. Die Verstöße betrafen unter anderem das Internationale Übereinkommen MARPOL und das Ballastwasser-Abkommen. Das ist zu viel. Deswegen müssen wir die Einhaltung der Abkommen noch genauer überprüfen. Mit regelmäßigen Schulungen und Workshops unterstützt das BSH diese Arbeit.“
Heegewaldt weist auch darauf hin, dass sich alle der Bedeutung gesunder Meere bewusst sein müssen: „Eine noch intensivere Aufklärung über die Bedeutung der Meere für unser Klima und unser Leben ist ebenso wichtig. Das ist unser aller Aufgabe, auch die der Reedereien und aller anderen, die die Meere nutzen.“ Heegewaldt sieht in dieser Aufgabe auch eine wesentliche Rolle der Ozeandekade der Vereinte Nationen (Dekade für Meeresforschung für Nachhaltige Entwicklung 2021-2030).
Rund 1,2 Millionen Seeleute sind weltweit unterwegs, darunter rund 7000 deutsche Seefahrerinnen und Seefahrer. Sie sorgen dafür, dass der weltweite Handel mit Gütern und Waren über den ganzen Globus funktioniert – ohne die Deutschlands Infrastruktur und die Handelsketten nicht überlebensfähig wären. Sie sorgen dafür, dass fast 400 Hochsee-Kreuzfahrtschiffe unterwegs sein können. Und sie sorgen dafür, dass Spezialschiffe wie Forschungs- und Offshore-Errichterschiffe im Einsatz sind und so auch die Energiewende voran kommt. Der Internationale Tag der Seefahrer weist jährlich am 25. Juni auf ihre Bedeutung hin. Er wurde im Jahr 2011 von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) ins Leben gerufen.
Das Bremer Unternehmen Hegemann Dredging hat vor kurzem seinen Neubau "Hegemann V" in Bremerhaven getauft. Das unter Deutscher Flagge fahrende Baggerschiff ist bereits seit Ende Februar im Einsatz und fährt mit einer deutschen Schiffsbesatzung. (19.06.2023)
Der Schiffskasko des 76m langen, 16 Meter breiten und 4,5m tiefgehenden Laderaumsaugbaggers wurde auf der serbischen Kladovo-Werft gebaut und dann über die Donau, Constanza (Rumänien) über das Schwarze Meer und Mittelmeer in die Niederlande verschleppt, wo dann auf der Werft Kooimann der Endausbau erfolgte.
Die knapp 23 Millionen teure "Hegemann V" war bereits seit dem 25. Februar für Unterhaltungsbaggerarbeiten auf der Unterems eingesetzt worden. Nun erfolgte die Taufe in Bremerhaven.
Die 2.446 BRZ große "Hegemann V" fährt unter Deutscher Flagge mit Heimathafen Bremen. Das Schiff wird von einer maximal achtköpfigen Besatzung geführt. Auch können Auszubildende für die praktische Ausbildung an Bord untergebracht werden.
Mit einem 30m langen Saugrohr auf der rechten (Steuerbord-)Seite des Schiffes und einer leistungsstarken Pumpe kann die "Hegemann V" große Mengen Sand und Schlick vom Meeresboden aufsaugen, in den 1.950 m³ umfassenden Laderaum pumpen und dann an die vorgesehenen Verbringungsstellen wieder entlassen.
Die Klassifikationsgesellschaft Bureau Veritas hat für die "Hegemann V" einen "Green Passport" erteilt, mit dem während des gesamten Schiffslebens alle potentiell gefährlichen Materialien an Bord erfasst und regelmäßig überprüft werden.
Das neue Baggerschiff ersetzt die 1982 gebaute "Hegemann IV", die in die Türkei verkauft wurde.
Das Unternehmen Hegemann GmbH Dredging mit Sitz in Bremen ist Teil der Hegemann-Reiners-Gruppe und ist auf Baggerarbeiten im Seebereich spezialisiert, darunter Unterhaltungsbaggerung von Seeschifffahrtsstraßen, Strandvorspülungen, Landgewinn und Hafenprojekte. Die Flotte des Bereichs Nassbaggerei umfasst derzeit vier Laderaumsaugbagger sowie weitere Schiffe. Die Haupteinsatzgebiete sind die europaweiten Küstengewässer der Nord- und Ostsee bis hin zum Mittelmeer.
Aktuell gibt es kein Verfahren, um nautische Schiffsausrüstung mit KI zu prüfen. In einer kürzlich veröffentlichten Studie haben das BSH sowie das Fraunhofer-CML gemeinsam bereits auf dem Markt verfügbare Systeme mit KI-Ansatz analysiert sowie ein entsprechendes Prüf- und Sicherheitskonzept entwickelt. So könnten in Zukunft Systeme mit KI an Bord zugelassen werden, um die Schifffahrt sicherer und effizienter zu machen. (12.6.2023)

Die Marktanalyse zeigt, dass KI-Systeme hauptsächlich eingesetzt werden, um Hindernisse zu identifizieren, ein Lagebild der aktuellen Situation zu erstellen, das Verhalten von anderen Schiffen vorherzusagen sowie Routen zu planen und zu optimieren. Basierend auf der Marktanalyse, haben die Studienautoren ein modellübergreifendes Konzept entwickelt, mit dem das BSH die Sicherheit und Funktion von beliebigen KI-Systemen in Zukunft prüfen kann. Dabei geht es vor allem darum, ob und nicht wie ein System funktioniert.
Die Autoren leiten aus den Ergebnissen verschiedene Handlungsempfehlungen ab und schaffen damit eine Diskussionsgrundlage für die Implementierung von Prüf- und Zertifikationsprozessen für KI-Systeme. Diese erleichtern unter anderem den Informationsaustausch zwischen Systemkomponenten und die Skalierbarkeit der Prüfprozesse. Ein darauf abgestimmtes Sicherheitskonzept unterstützt die Hersteller, relevante Aspekte bereits bei der Entwicklung zu berücksichtigen, um KI-Systeme zeitnah prüfen zu können.
BSH-Präsident Helge Heegewaldt erläutert: „Die Digitalisierung in der Seeschifffahrt hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Durch derartige Forschung und Entwicklung trägt das BSH zusammen mit seinen Kooperationspartnern dazu bei, dass in Zukunft Systeme mit künstlicher Intelligenz an Bord zugelassen werden könnten.“
Die Reederei claus rodenberg waldkontor gmbh hat jetzt den 108m langen Frachter "St. Pauli 2" (eh. "Sylvia") unter die Deutsche Flagge gebracht. Die Einflaggung erfolgte in Lettland. Die Reederei ist spezialisiert auf den Seetransport von Holzprodukten. (8.6.2023)
Die deutsche Seeschifffahrt ist durch viele kleine und mittlere Reedereien geprägt. 80% der deutschen Reedereien haben weniger als 10 Schiffe. Dazu gehört auch die claus rodenberg waldkontor gmbh aus dem holsteinischen Kastorf, die vier Frachtschiffe betreibt und mit der jetzigen Einflaggung der "St. Pauli 2" die Hälfte ihrer Schiffe unter Deutscher Flagge betreibt. Die 3.999 BRZ vermessende "St. Pauli 2" fuhr zuvor als "Sylvia" unter Gibraltar-Flagge.
Die Rodenberg-Gruppe deckt als unabhängiger Dienstleister die gesamte Lieferkette rund um die Wald- und Holzwirtschaft ab. Die über 300 Mitarbeiter sind von der Holzernte bis zur Lieferung der Holzprodukte per LKW, Bahn und See- und Binnenschiff verantwortlich. Im Geschäftsfeld "Schifffahrt und Häfen" betreibt das Unternehmen einen eigenen Kai in Lübeck für den Umschlag und Lagerhaltung von Holzprodukten. Den Transport übernehmen dann unter anderem die vier firmeneigenen Seeschiffe.
Der langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung der ehemaligen See-Berufsgenossenschaft (See-BG) und Seekasse, Reimer Göttsch, ist am 16. Mai 2023 im Alter von 88 Jahren verstorben. Reimer Göttsch war lange Zeit eine prägende Größe der deutschen See-Sozialversicherung und der Seeschifffahrt. (06.06.2023)

Nach dem - damals noch vierjährigen - Referendariat und der Großen Juristischen Staatsprüfung trat er am 1. Juni 1961 seinen Dienst bei der See-Berufsgenossenschaft an. In seinen ersten Dienstjahren beschäftigten ihn vornehmlich die Themen der Kranken- und Rentenversicherung sowie dienstrechtliche Angelegenheiten. 1966 hospitierte er bei der Generaldirektion V der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaften in Brüssel und bei dem französischen Träger der Rentenversicherung für Seeleute (Etablissement National des Invalides de la Marine).
Ab dem 1. Mai 1969 leitete er die Mitglieder- und Beitragsabteilung, die Abteilung Rechenzentrum (später EDV bzw. IT), der Organisationsabteilung sowie der Leistungsabteilung der See-Krankenkasse und ab dem 1. Mai 1972 auch der Rentenversicherung.
Ab dem 1. Oktober 1972 koordinierte er als Hauptreferent fünfzehn Jahre lang die Arbeit der Abteilungsleiter für die gemeinsame Geschäftsführung, bevor er am 1. Oktober 1982 selbst in die Geschäftsführung und ab dem 1. Juli 1987 zu deren Vorsitzenden berufen wurde. Er vertrat die See-Berufsgenossenschaft und die Seekasse in den Spitzengremien und Fachausschüssen der deutschen Sozialversicherung.
Neben seiner Tätigkeit für die See-Berufsgenossenschaft/Seekasse nahm Reimer Göttsch verschiedene Lehraufträge wahr. So war er von 1969 bis 1986 Dozent im Fortbildungsbereich an der Verwaltungsschule des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (heute DGUV) sowie an der berufsgenossenschaftlichen Akademie in Hennef. Über drei Semester nahm er 1979/80 einen Lehrauftrag an der Universität Hamburg, Fachbereich Jura, für den Schwerpunkt "Soziale Sicherung" wahr. Von 1985 bis 1993 dozierte er zum gleichen Thema an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg.
Auch im juristischen Schrifttum ist Reimer Göttsch sehr aktiv gewesen: So war er Mitautor der Kommentare "Gesetzliche Unfallversicherung" von Lauterbach/Watermann, "Seemannsrecht" und schrieb für das "Handbuch des Sozialversicherungsrechts" von Schulin.
Seit 1994 bis zu seiner Pensionierung war er Vorsitzender des wichtigen Dienstrechtsausschusses des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Zudem fungierte er seit 1993 als ehrenamtlicher Richter am Bundessozialgericht in Kassel.
Sein fachlicher Rat wurde nicht nur in Politik und Ministerien gesucht und geschätzt. 1987/88 wurde er vom Lotsenbetriebsverein e.V. in Hamburg und der damaligen Gewerkschaft ÖTV zum Einzelschlichter in der Tarifauseinandersetzung berufen.
Reimer Göttsch erhielt in Anerkennung seiner herausragenden Dienste die Verdienstmedaille der Deutschen Rentenversicherung. Der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland verlieh Reimer Göttsch für seine besonderen Verdienste das Verdienstkreuz am Bande.
Reimer Göttsch war einer der ganz Großen in der deutschen Sozialversicherung. Jeder, der das Glück hatte, ihn zu kennen, wird sich gerne an seinen Humor und seine große Menschlichkeit erinnern.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
In seinem neuesten Film hat der Hamburger Fotograf und Filmemacher Patrick Ludolph das Thema Deutsche Flagge aufgegriffen. In seinem Gespräch mit Christian Bubenzer von der BG Verkehr geht es unter anderem um die Vorteile der Deutschen Flagge, Ausflaggungen und die Seefahrt-Ausbildung. Unterdessen ist der NDR auf einem deutschflaggigen Containerschiff mitgefahren und berichtet über das Leben eines gestandenen Kapitäns auf See und an Land. (02.06.2023)


Auch in der NDR-Reportage "Von Hamburg-Cranz nach Casablanca" spielt die Deutsche Flagge eine Rolle – genauer gesagt beim Containerschiff "Henneke Rambow", das unter Deutscher Flagge fährt. Im Vordergrund des 45-minütigen Films aus der Reihe "Die Nordstory" steht allerdings der erfahrene Kapitän dieses Schiffes. Der NDR hat den aus Hamburg-Cranz stammenden Kapitän Ingo Drewes und seine Crew auf seinem Schiff bis nach Marokko begleitet. Das Feederschiff "Henneke Rambow" wird von der in Drochtersen ansässigen Reederei Rambow betrieben. Die Reederei fährt sechs ihrer insgesamt zwölf Schiffe unter Deutscher Flagge. Auch ist das familiengeführte Unternehmen stark in der Ausbildung von seemännischen Nachwuchs engagiert.
Die Hamburger Reederei Fairplay Towage hat vor kurzem ihren Neubau "Fairplay 91" getauft. Der Assistenzschlepper fährt unter Deutscher Flagge. Auch in der Ausbildung des seemännischen Nachwuchses ist Fairplay stark engagiert. (02.06.2023)

Die "Fairplay 91" fährt unter Deutscher Flagge. Die Hamburger Traditionsreederei Fairplay Towage setzt damit ihr langjähriges Bekenntnis zur Deutschen Flagge fort. Auch im Bereich der seemännischen Ausbildung ist die im Jahr 1905 gegründete Reederei sehr aktiv. Seit 2003 bietet Fairplay die Ausbildung zum Schiffsmechaniker an. 2015 wurde die Bugsier Reederei, die seit 2017 zur Fairplay-Firmengruppe gehört, als "Exzellenter Ausbildungsbetrieb" von der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt ausgezeichnet.
Die Reederei Fairplay Towage ist eine der führenden Schleppreedereien in Europa und betreibt insgesamt 105 Schlepper verschiedenster Klassen. Neben den reinen Hafenschleppdiensten ist die Reederei auch weltweit in der Schleppschifffahrt sowie im Offshore- und im Bergungsgeschäft tätig.
Der Sturz ins Meer ist eine hochgefährliche Situation und die sichere Rettung äußerst schwierig. Im Rahmen der Rettungsmittel-Sonderausstellung im Cuxhavener Wrack- und Fischereimuseum "Windstärke 10" berichten Prof. Michael Schwindt und Kapitän Ortwin Mühr von der CPO Containerschiffreederei HH am 6. Juni 2023 in einem gemeinsamen Vortrag vom Einsatz des RescueStar: "Fortschritt rettet Leben – Der RescueStar, ein modernes Seenotrettungsgerät und sein Einsatz". (30.05.2023)

"Fortschritt rettet Leben – Der RescueStar, ein modernes Seenotrettungsgerät und sein Einsatz"
6 Juni 2023 19 Uhr
Eintritt 3,50€ - 4,00€
"Windstärke 10" − Wrack- und Fischereimuseum Cuxhaven
Ohlroggestraße 1
27472 Cuxhaven
erläutert zunächst Prof. Michael Schwindt die Funktion und die Entwicklung des RescueStar, welche die damalige See-Berufsgenossenschaft begleitet hat.
Im Anschluss an den Vortragsteil zur Entwicklungsgeschichte berichtet Kapitän Ortwin Mühr von der CPO Containerschiffreederei in Hamburg von einer Rettungsaktion im südchinesischen Meer und ein speziell für diese Rettung von ihm entwickeltes Schiffsmanöver. Damals war das Frachtschiff "Vandon ACE" gesunken. Die Besatzung des Containerschiffs "MSC Rapallo" der Reederei CP Offen fand sieben Stunden nach dem Unglück vier Besatzungsmitglieder des gesunkenen Schiffes im Wasser treibend. Mit dem RescueStar konnten die Schiffbrüchigen bei starkem Sturm (10 Windstärken) und 5 Meter Wellenhöhe gerettet werden. Eine Rettungsleiter hätten die erschöpften Seeleute aus eigener Kraft nicht mehr hinaufklettern können und auch ein sicheres Aussetzen eines Rettungsbootes wäre bei dem starken Wellengang nicht möglich gewesen.
Der Vortrag findet im Rahmen der Sonderausstellung "Safety First - Rettungsmittel an Bord" im "Windstärke 10" − Wrack- und Fischereimuseum Cuxhaven statt. Die Sonderausstellung selbst läuft noch bis zum 31. Oktober 2023. Sie kann während der normalen Öffnungszeiten besucht werden und ist im Eintrittspreis enthalten.
Die Macher der Sonderausstellung spannen den Bogen von den Anfängen der Rettungsmittel im 19. Jahrhundert bis heute. Bereits 1891 regelte die damalige See-Berufsgenossenschaft mit ihren Unfallverhütungsvorschriften die Ausrüstung von deutschflaggigen Handelsschiffen mit Rettungsmitteln – und war damit Vorreiter. Aber erst der Untergang der "Titanic" im Jahr 1912 sorgte mit dem daraus entstandenen Internationalen Übereinkommen zum Schutz menschlichen Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen) für einen internationalen Mindeststandard, der bis heute immer weiter fortentwickelt wurde.
Dabei kommen verschiedenste kollektive und individuelle Rettungsmittel zum Einsatz, was die Sonderausstellung multimedial und mit vielen interessanten Ausstellungsstücken veranschaulicht.
Weitere Informationen zum Thema Rettungsmittel und die Arbeit der Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr auf diesem Gebiet erhalten Sie auf unserer Website in der Rubrik "Bau · Ausrüstung". Dort werden unter anderem verschiedene Rettungsgeräte in kurzen, spannenden Filmen vorgestellt.
Ab sofort können alle vom BSH ausgestellten Bescheinigungen für Seeleute (Befähigungszeugnisse und -nachweise sowie Seeleute-Ausweise) in einem neuen Online-Verfahren auf ihre Echtheit und Gültigkeit überprüft werden.
Unternehmen und Behörden, die dieses Verfahren nutzen möchten, müssen einen rechtlichen Anspruch im Sinne von § 9f Seeaufgabengesetz glaubhaft machen. In Frage kommen z.B.
- Unternehmen, die Seeleute mit deutschen Bescheinigungen beschäftigen oder
- ausländische Flaggenstaatsverwaltungen, die Anerkennungsvermerke zu deutschen Bescheinigungen für den Dienst auf einem Schiff unter ihrer eigenen Flagge ausstellen.
Für die neue Online-Verifikation (Fachverfahren „SBVOV: Verifikation“) ist einmalig eine Registrierung über BSH-Login erforderlich. Nach der Registrierung steht die Online-Verifikation in deutscher und englischer Version zur Verfügung.
Das neue Verfahren löst die alte Anwendung zur Überprüfung der Echtheit und Gültigkeit von deutschen Seeleute-Bescheinigungen ab, mit der nicht alle Arten von Bescheinigungen verifiziert werden konnten. Außerdem wurde die Benutzerregistrierung modernisiert.
Neues Verfahren zur Online-Verifikation deutscher Seeleute-Bescheinigungen
Neues Verfahren zur Online-Verifikation deutscher Seeleute-Bescheinigungen
Ab sofort können alle vom BSH ausgestellten Bescheinigungen für Seeleute (Befähigungszeugnisse und -nachweise sowie Seeleute-Ausweise) in einem neuen Online-Verfahren auf ihre Echtheit und Gültigkeit überprüft werden.
Unternehmen und Behörden, die dieses Verfahren nutzen möchten, müssen einen rechtlichen Anspruch im Sinne von § 9f Seeaufgabengesetz glaubhaft machen. In Frage kommen z.B.
- Unternehmen, die Seeleute mit deutschen Bescheinigungen beschäftigen oder
- ausländische Flaggenstaatsverwaltungen, die Anerkennungsvermerke zu deutschen Bescheinigungen für den Dienst auf einem Schiff unter ihrer eigenen Flagge ausstellen.
Für die neue Online-Verifikation (Fachverfahren „SBVOV: Verifikation“) ist einmalig eine Registrierung über BSH-Login erforderlich. Nach der Registrierung steht die Online-Verifikation in deutscher und englischer Version zur Verfügung.
Das neue Verfahren löst die alte Anwendung zur Überprüfung der Echtheit und Gültigkeit von deutschen Seeleute-Bescheinigungen ab, mit der nicht alle Arten von Bescheinigungen verifiziert werden konnten. Außerdem wurde die Benutzerregistrierung modernisiert.
Der Seeärztliche Dienst der BG Verkehr ist für die Qualität der Seediensttauglichkeitsuntersuchungen verantwortlich. Die Untersuchungen nehmen dafür zugelassene Ärztinnen und Ärzte in ihren eigenen Praxen in ganz Deutschland vor. Der Seeärztliche Dienst führt regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen durch – diesmal auf der MS Helgoland ab Cuxhaven. (16.05.2023)

Umso wichtiger ist es sicherzustellen, dass Männer und Frauen, die auf Seeschiffen arbeiten, physisch und psychisch gesund sind. In Deutschland führen derzeit 63 Ärztinnen und Ärzte Seediensttauglichkeitsuntersuchungen für den Seeärztlichen Dienst (SÄD) durch. Um vom SÄD zugelassen zu werden, sind einige Grundvoraussetzungen zu erfüllen - allem voran eine Facharztzulassung für Allgemeinmedizin, Arbeitsmedizin, Anästhesiologie, Chirurgie oder Innere Medizin sowie eine mindestens vierjährige Berufserfahrung in diesem Bereich. Außerdem ist eine vierwöchige praktische Erfahrung auf einem Seeschiff obligatorisch, die vom Marine-Background bis hin zu einem Reederei-Praktikum reichen kann. Nach der Zulassung durch den SÄD müssen die Ärztinnen und Ärzte mindestens 300 Seediensttauglichkeitsuntersuchungen in drei Jahren durchführen, um mit der besonderen Thematik vertraut zu bleiben. Und auch stetige Weiterbildung ist wichtig.
Alle drei Jahre müssen Ärztinnen und Ärzte, die Seediensttauglichkeitsuntersuchungen durchführen, an einer Schulungsveranstaltung des Seeärztlichen Dienstes teilnehmen. In der Regel finden diese Schulungen in den Räumen des SÄD in Hamburg statt. Aber allen Medizinern, die Meer wollen, wird Meer geboten – und sie können sich für eine Schulung an Bord anmelden. Diesmal ging es auf die Fähre MS Helgoland, in den letzten Jahren auch mal auf das Segelschiff Alexander von Humboldt II, das Forschungsschiff Polarstern und das Kreuzfahrtschiff AIDAprima.
An der Schulung vom 28. April nahmen fünfzehn Ärztinnen und Ärzte teil. Fachleute des Seeärztlichen Dienstes informierten unter anderem über das Seearbeitsgesetz, die psychischen Belastungen in der Seefahrt, den psychologischen Eignungstest für Seelotsenbewerber und neue Diabetes-Warnsysteme. Später hatten alle Gäste die Möglichkeit, sich von Kapitän Ewald Bebber in Kleingruppen durchs Schiff führen zu lassen, vom Maschinenraum über die Krankenstation bis hinauf auf die Brücke. Dabei wurde wieder einmal deutlich: Ein Seeschiff mit seinen teilweise winzigen Räumen, steilen Treppen und schwankenden Böden ist ein sehr spezieller Arbeitsplatz. Auch deswegen sind die Tauglichkeitsuntersuchungen so wichtig.
Als die EU-Kommission Ende Februar ihren Aktionsplan vorstellte, der unter anderem ein Verbot der Fischerei mit Grundschleppnetzen in Meeresschutzgebieten vorsah, löste das große Sorgen bei den Betroffenen aus. Jetzt hat die Kommission klargestellt: Ein pauschales Verbot wird es nicht geben. Derweil zeigen aktuelle Forschungsergebnisse des Thünen-Institutes, dass die Krabbenfischerei nur geringe Auswirkungen auf den Meeresboden hat. (10.05.2023)

- in Natura-2000-Gebieten bis Ende März 2024 und
- in allen Meeresschutzgebieten der EU bis spätestens 2030
zu verbieten. Dazu sollten die EU-Mitgliedsstaaten ihre nationalen Maßnahmen laut Aktionsplan bereits bis Ende März 2024 verabschiedet haben und der EU-Kommission einen konkreten Fahrplan für die schrittweise Einstellung der Grundschleppnetz-Fischerei bis 2030 in allen EU-Meeresschutzgebieten vorlegen.
Nachdem sich viele deutsche Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker gegen ein pauschales Verbot der Grundschleppnetz-Fischerei in Meeresschutzgebieten aussprachen, hat die EU-Kommission jetzt Kompromissbereitschaft signalisiert. Eine Sprecherin der EU-Kommission hat vor kurzem deutlich gemacht, dass die Grundschleppnetz-Fischerei auf Krabben und Plattfische nicht automatisch zum 1. März 2024 verboten wird. Zudem hat der EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei Virginijus Sinkevicius in einem Schreiben vom 3. April an drei Europa-Abgeordnete klargestellt: "Entgegen vielen Gerüchten plant die Europäische Kommission für März 2024 kein pauschales Verbot von Grundschleppnetzen in Meeresschutzgebieten". Ihm sei bewusst, dass die "Krabbenfischerei eine wichtige Rolle für die Kultur des Nordens und den regionalen Tourismus in unseren Küstenregionen spielt", so Sinkevicius. Der Dialog und der Austausch mit den Betroffenen sei ihm wichtig; jetzt gehe es darum, den Übergang zu weniger schädlichen Fanggeräten weiter zu gestalten. Grundschleppnetze mit Rollen, die an der Küste eingesetzt würden, belasteten den Meeresboden schon weniger als in der Fischerei auf Plattfische eingesetzten Schleppnetze. In diese Richtung gälte es weiter zu denken, so Sinkevicius. Mit seinem Schreiben antwortet der EU-Kommissar auf einen "Brandbrief" der drei Europaabgeordneten David McAllister, Jens Gieseke und Niclas Herbst von Ende März. Die CDU-Politiker hatten in ihrem "Brandbrief" gefordert, den Vorschlag eines Verbots der grundberührenden Fischerei im Aktionsplan der EU-Kommission ersatzlos zu streichen.
Ist damit das Verbot der Grundschleppnetzfischerei in Meeresschutzgebieten vom Tisch?Die deutschen Krabbenfischer bleiben skeptisch. Dirk Sander, Vorsitzender des Landesfischereiverbandes Weser-Ems, befürchtet laut Zeitungsmeldung: "Dann kommt das scheibchenweise in der Zeit danach". Selbst wenn der Aktionsplan der EU-Kommission so nicht umgesetzt werde, sei für die Fischer bereits ein Schaden entstanden. Wenn nämlich Fischer mit Banken redeten, würden die denken: Es kann auch ganz schnell vorbei sein mit der Krabbenfischerei, so Sander.
Unterdessen hat das bundeseigene Thünen-Institut am 27. April den Abschlussbericht zu seinem Forschungsprojekt CRANIMPACT vorgelegt. Die Fischereiexperten hatten vier Jahre lang die Auswirkungen der Krabbenfischerei auf den Meeresboden in der deutschen Nordsee untersucht. Das Fazit der Forscher: Die Krabbenfischerei hat nur einen geringen Einfluss auf die Artgemeinschaften des Meeresbodens. Für die Arten, für die ein Einfluss der Fischerei nachgewiesen werden konnte, wurden kurze Erholungszeiten von maximal 20 Tagen festgestellt. Die Unterschiede zwischen einem Gebiet im dänischen Wattenmeer, in dem seit 40 Jahren nicht mehr gefischt wird, und den befischten deutschen Wattengebieten, seien gering, so das Thünen-Institut für Seefischerei.
Mit den aktuellen Erkenntnissen des Thünen-Instituts werden die bereits 30 Jahre alten Forschungsergebnisse der Ökosystemforschung Wattenmeer bestätigt. Schon damals war in Zusammenhang mit der Errichtung der Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer festgestellt worden, dass die Krabbenfischerei mit der Baumkurre keine nennenswerten schädigenden Einflüsse auf den Meeresboden hat.
Weitere Informationen zu der Gesamtthematik enthält unsere Nachricht vom 21.3.2023.
Mit großer Mehrheit der 98 Mitgliedstaaten hat die 3. Vollversammlung der Internationalen Hydrographischen Organisation (IHO) den amtierenden Generalsekretär Dr. Mathias Jonas in seinem Amt bestätigt. Er ist der erste deutsche Generalsekretär der international maßgeblichen Institution für die Vermessung des Ozeans und die Herstellung von Seekarten. (04.05.2023)
Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, begrüßte die Wahl des deutschen Hydrographen: „Dr. Mathias Jonas hat in diesem Amt wesentlich zur Modernisierung und Digitalisierung sowohl der Vermessung als auch der Navigation und der damit verbundenen Systeme beigetragen. Das hilft uns enorm dabei, die Nutzung der Meere nachhaltiger zu gestalten. Ich freue mich sehr, dass die IHO unter seinem Vorsitz diesen innovativen Kurs weiter halten wird.“
Helge Heegewaldt, Präsident des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, gratulierte dem neuen Generalsekretär: „Herzlichen Glückwunsch, lieber Mathias Jonas! Ich freue mich sehr über die Wiederwahl von Herrn Dr. Mathias Jonas als Generalsekretär der Internationalen Hydrographischen Organisation (IHO) heute auf der 3. Assembly in Monaco. Er wird damit auch die nächsten drei Jahre die Geschicke der IHO lenken. Mit seiner verbindlichen, respektvollen und angenehmen Art sowie seinem diplomatischen Geschick und seiner fachlichen Expertise in der nautischen Hydrographie hat er schon in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet und die Bedeutung der nautischen Hydrographie und auch der IHO sichtbar gemacht. Nun kann er diese tolle Arbeit fortsetzen. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und eine glückliche Hand!“
Die Bedeutung der Hydrographie ist unverzichtbare Voraussetzung für Schutz und nachhaltige Nutzung der Meere. Bisher sind lediglich 25 Prozent des gesamten Meeresbodens vermessen. Rund 300 Millionen Quadratkilometer Meeresboden von der Küste bis in die Tiefsee sind bisher im Detail nahezu unbekannt.
Eine vollständige Karte des Meeresbodens wird das Wissen über seine Prozesse und damit über die Ozeane insgesamt verbessern und einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung eines nachhaltigen Meeresmanagements leisten. Dazu gehört auch der Umgang mit Herausforderungen wie der Zerstörung der marinen Umwelt, dem Klimawandel, Georisiken und den Ansprüchen einer wachsenden marinen Industrie, nicht zuletzt auch der Offshore-Windenergie. Im Rahmen des Projektes Seabed 2030, einem Projekt der UN-Ozeandekade, arbeiten Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und internationalen Organisationen an einer vollständigen Vermessung der Meere. Die Daten werden im Datenzentrum für digitale Bathymetrie der IHO gesammelt und zur Verfügung gestellt.
Als zwischenstaatliche Organisation engagiert sich die IHO auf allen Themenfeldern der Hydrographie. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen die internationale Zusammenarbeit in der Vermessung der Meere und die Erstellung von Papier- und elektronischen Seekarten. Sie definiert internationale technische Standards, koordiniert die Arbeit der nationalen hydrographischen Büros und Institutionen und engagiert sich im Bereich der nautischen Hydrographie unter anderem in Entwicklungsländern. Die IHO hat einen Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen.
Für Deutschland, seit 1926 Mitglied, engagiert sich das BSH sowohl auf technischem Gebiet als auch in Fragen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Nordsee- und Ostseeraum für die Umsetzung. Eine wichtige Rolle spielt es dabei bei der Entwicklung des neuen S-100-Standards für Seekarten. Er ist ein Rahmenwerk für die Standardisierung mariner Datenprodukte wie die hochauflösende Bathymetrie, Oberflächenströme, Meeresschutzgebiete und neue Normen für die elektronische Navigationskarten ENC. Für die Vermessung des Meeresbodens in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone von Nordsee und Ostsee ist das BSH zuständig. Mit seinen 5 Vermessungs-, Wracksuch und Forschungsschiffe vermisst es nach genau festgelegten Zeitplänen die rund 33.000 qm große Meeresfläche. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.bsh.de.
Im Zuge der Sanktionsmaßnahmen gegenüber Russland wurden die Anträge auf eine Ausflaggungsgenehmigung aktualisiert. Erfahren Sie mehr in der Rubrik "Ausflaggung" unter der Überschrift "Sanktionsmaßnahmen gegen Russland".
Die Hochschule Emden/Leer und das Konstruktionsbüro Judel/Vrolijk aus Bremerhaven entwickeln derzeit den "Kutter der Zukunft". Der 19,5 Meter lange moderne Fischkutter soll später mit umweltfreundlichem Methanol-Antrieb in Serie gehen und so die deutsche Fischereiflotte modernisieren. Das Abschluss-Kolloquium zu diesem Projekt wird im Sommer stattfinden. (25.04.2023)

Der Großteil der deutschen Fischereiflotte ist veraltet; das Durchschnittsalter liegt mittlerweile bei 40 Jahren. In solch alte Kutter lassen sich aber technisch und wirtschaftlich keine klimaneutralen Schiffsantriebe einbauen – und genau an dieser mittel- bis langfristigen Zielvorgabe wird auch die Fischerei nicht vorbeikommen können. Auch deshalb hat Hilke Looden, Bürgermeisterin der ostfriesischen Gemeinde Krummhörn (zu der auch Greetsiel gehört), frühere Fischereiberaterin bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und Ehefrau eines Krabbenfischers, die Initiative für die Entwicklung eines modernen Fischkutters ergriffen.
Der Leiter des Projektteams ist Prof. Dr.-Ing. Jann Strybny, der an der Hochschule Emden/Leer im Bereich Maritime Umwelttechnik in der Seefahrt lehrt und forscht. Zusammen mit seinem Kollegen Prof. Kapt. Michael Vahs hat er die wissenschaftliche Leitung der Fraunhofer-Arbeitsgruppe Nachhaltige Maritime Mobilität übernommen, die zu gleichen Teilen von der Hochschule Emden/Leer und vom Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES in Bremerhaven getragen wird.
Die Fischkutter-Studie wird im Zuge eines vom Landwirtschaftsministerium Niedersachsen bewilligten Projektes durchgeführt, das durch den Europäischen Meeres- und Fischereifonds EMFF der EU und das Land Niedersachsen gefördert.
Projektmitarbeiter Tammo Lenger hat 220 Fischereibetriebe angeschrieben und gezielt ermittelt, welche Vorstellungen die späteren Nutzer von einem modernen Fischereifahrzeug haben. 34 Krabbenfischer vor allem aus dem ostfriesischen Bereich haben sich an der Umfrage beteiligt, dessen Ergebnisse in den schiffbaulichen Entwurf (verantwortet vom Bremerhavener Konstruktionsbüro Judel/Vrolijk) eingeflossen sind. Ausgangspunkt für das Konzept-Design des "Kutters der Zukunft" ist die Rumpfform des klassischen Lübbe-Voss-Kutters.
Und so soll der "Kutter der Zukunft" aussehen:
- Die Maße des Kutters sind: 19,5m lang, 5,90m breit und 2m Tiefgang. Der Kutter ist bewusst groß konzipiert worden, um die Null-Emissions-Antriebstechnik und die nötigen Tankkapazitäten für künstliche Kraftstoffe unterbringen zu können.
- Das Ruderhaus ist vorne. Die Projektverantwortlichen versprechen sich dadurch mehrere Vorteile: Im Nachtbetrieb werden Blendungen des Schiffsführers durch die Beleuchtung des Arbeitsdecks vermieden. Der Wetterschutz ist auf dem Achterdeck besser. Das Steuerhaus und die technischen Komponenten sind räumlich eng beieinander positioniert. Die Unterkünfte an Bord und der Fischereibetrieb sind voneinander getrennt.
- Die Unterkünfte sind im Vordeck angeordnet.
- Der Laderaum soll etwa 330 Standard-Fischkisten umfassen.
- Das Schiff soll umweltfreundlich mit Methanol angetrieben werden (daher auch der lange Entlüftungs-Mast). Ein Elektromotor mit zwei großen und einem kleinen Stromgenerator (zu- und wegschaltbar) soll in einem gesonderten Raum untergebracht werden. Nach Angaben der Projektverantwortlichen ist Wasserstoff an Bord von Fischereifahrzeugen wegen der zu großen Drucktanks schon aus Platzgründen nicht realisierbar.
- Die Konzept-Design des Fischkutters ist bewusst multifunktional gehalten, damit das Schiff später vielfältig einsetzbar ist und damit eine bessere Finanzierung möglich wird.
Nach Schätzung von Prof. Dr. Strybny ist bei einem Kutter dieser Größenordnung derzeit mit Kosten von rund 2 Mio. EUR als Einzelprojekt zu rechnen. Es ist das Ziel, durch eine angedachte Serienfertigung (mindestens fünf Kutter) und den Verzicht auf individuelle Zusatzwünsche von Fischern die Baukosten so gering wie möglich zu halten. Klar sei aber auch, so Prof. Dr. Strybny, dass ohne öffentliche Förderung der Prototyp und die späteren Kutter für die Fischer nicht finanzierbar seien.
Derzeit führt Philip Deckena von der Fraunhofer-Arbeitsgruppe Nachhaltige Maritime Mobilität mit einem Modell des Kutters Schlepptankversuche in dem im September 2021 neu eröffneten Maritimen Technikum in Leer durch. Im Sommer will die Hochschule Emden/Leer ein Abschlusskolloquium zu dem Projekt veranstalten. Torsten Conradi, Geschäftsführer von Judel/Vrolijk, und sein Mitarbeiter Matthias Bröker halten den Neubau des "Kutters der Zukunft" in zwei bis drei Jahren für möglich – wenn das Projekt auch von der Politik mit unterstützt wird.
Das Cuxhavener Wrack- und Fischereimuseum Cuxhaven "Windstärke 10" zeigt derzeit eine Sonderausstellung zu Rettungsmitteln in der Seeschifffahrt. Unter dem Titel "Safety First – Rettungsmittel an Bord" präsentieren die Museumsmacher Rettungswesten, Rettungsinseln und andere Geräte zur Rettung aus See. Die Ausstellung ist noch bis zum 31. Oktober zu sehen. (19.04.2023)

Wie praxistauglich der Rescue Star ist, zeigt eine geglückte Rettungsaktion im Februar 2022 im Südchinesischen Meer, über die in der Ausstellung in Cuxhaven berichtet wird. Damals war das Frachtschiff "Vandon ACE" gesunken. Die Besatzung des Containerschiffs "MSC Rapallo" der Reederei CP Offen fand sieben Stunden nach dem Unglück vier Besatzungsmitglieder des gesunkenen Schiffes im Wasser treibend. Mit dem "Rescue Star" konnten die Schiffbrüchigen bei starkem Sturm (10 Windstärken) und 5 Meter Wellenhöhe gerettet werden. Eine Rettungsleiter hätten die erschöpften Seeleute aus eigener Kraft nicht mehr hinaufklettern können und auch ein sicheres Aussetzen eines Rettungsbootes wäre bei dem starken Wellengang nicht möglich gewesen.
Die Macher der Sonderausstellung spannen den Bogen von den Anfängen der Rettungsmittel im 19. Jahrhundert bis heute. Bereits 1891 regelte die damalige See-Berufsgenossenschaft mit ihren Unfallverhütungsvorschriften See (UVV See) die Ausrüstung von deutschflaggigen Handelsschiffen mit Rettungsmitteln – und war damit Vorreiterin in der internationalen Handelsschifffahrt. Aber erst der Untergang der "Titanic" im Jahr 1912 sorgte mit dem daraus entstandenen Internationalen Übereinkommen zum Schutz menschlichen Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen) für einen internationalen Mindeststandard, der bis heute immer weiter fortentwickelt wurde.
Die Ausstellung macht deutlich, welchen starken Einfluss die damalige See-Berufsgenossenschaft (See-BG) und die heutige BG Verkehr bei der Entwicklung von Rettungsmitteln hatte und nach wie vor hat – angefangen bei den detaillierten Vorgaben an Rettungsboote und ihre Bauweise in den UVV See von 1899 über die Zulassung von Rettungsflößen auf Fischereifahrzeugen im Jahr 1956 und der ersten Freifall-Rettungsboote aus glasfaserverstärktem Kunststoff in den 1970er-Jahren bis hin zu modernen Rettungsgeräten wie zum Beispiel dem "Rescue Star".
Die sehenswerte Sonderausstellung zeigt anschaulich und kurzweilig die Herausforderungen der Rettung von Seeleuten aus See – damals wie heute. Die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr hat die Ausstellung neben fachlichen Hinweisen mit einem Video, Fotos und einem Exemplar des Medizinischen Handbuchs See unterstützt.
"Safety First – Rettungsmittel an Bord" ist noch bis zum 31. Oktober 2023 im Wrack- und Fischereimuseum Cuxhaven zu sehen.
Zu ihrem zehnjährigen Bestehen hat die Stiftung "Schifffahrtsstandort Deutschland" ihr Förderprogramm ausgeweitet und die Förderbeiträge erhöht. Neu ist die Förderung von Elektrotechnischen Offiziersassistenten (ETOA). Reedereien können ihre Förderanträge ab sofort auch digital stellen. (04.04.2023)
Die Stiftung "Schifffahrtsstandort Deutschland" fördert seit inzwischen zehn Jahren die Berufsausbildung und -fortbildung von Seeleuten auf Schiffen unter deutscher Flagge oder EU-Flagge - vom Schiffsmechaniker bis hin zur Kapitänin. Finanziert wird der Fördertopf aus Ablösebeträgen, die Reeder ausgeflaggter deutscher Schiffe als Entschädigung zahlen müssen, wenn Sie keine Berufsausbildungen an Bord anbieten. Dieser Ablösebetrag ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben und liegt weiterhin je nach Schiffsgröße zwischen 2.051 Euro und 19.632 Euro pro Jahr (siehe Bekanntmachung im Bundesanzeiger Ende 2022).
Die Stiftung fördert die Berufsausbildung von:
- Schiffsmechaniker/-innen,
- Nautischen und Technischen Offiziersassistent/-innen und
- erstmals auch von Elektrotechnischen Offiziersassistent/-innen.
Weiterhin kann auch die Ausbildung von Nachwuchsoffizier/-innen (inkl. Kapitän/-innen) und berufliche Fortbildungen gefördert werden.
Eine weitere Neuerung ist die deutliche Anhebung der Förderbeträge für Berufsausbildungen: Schiffsmechanikerinnen und Offiziersassistenten werden mit 14.000 Euro im Jahr (bisher: 10.500 Euro) gefördert, die Ausbildung zum Kapitän oder zur Schiffsoffizierin mit 32.000 Euro (bisher: 24.000 Euro) und bei vorheriger Arbeitslosigkeit sogar mit 38.000 Euro (bisher: 28.500 Euro) im Jahr.
Die Voraussetzungen für die Förderung der Berufsausbildung und der Qualifizierung durch die Stiftung "Schifffahrtsstandort Deutschland" sind unter anderem:
- Das Unternehmen hat seinen Sitz in Deutschland.
- Der/die Azubi oder Kapitänin/Schiffsoffizier ist bei einem deutschen Arbeitgeber beschäftigt.
Der Arbeitgeber zahlt Beiträge für die gesetzliche Sozialversicherung für den/die Auszubildende/n oder den Kapitän/die Schiffsoffizierin.
- Der/die Auszubildende oder Kapitän/Schiffsoffizier erhält eine Vergütung in Höhe von mindestens 850,- EUR.
- Das Schiff fährt unter deutscher Flagge (keine Bundes- oder Landesdienstflagge) oder einer EU-Flagge oder neuerdings auch einer EWR-Flagge.
Alle Anträge auf Förderung können ab sofort auch digital gestellt werden. Um sich für das Serviceportal registrieren zu lassen, bittet die Stiftung um eine E-Mail an: info@stiftung-schiffffahrtsstandort.de
Weitere Informationen zum Thema sowie die Links zum postalischen Antrag finden Sie in unserer Rubrik "Finanzen".
Für Handelsschiffe unter deutsche Flagge sind einige neue Vorgaben für die medizinische Ausstattung an Bord in Kraft getreten. (24.03.2023)
Der neue "Stand der medizinischen Erkenntnisse" enthält neben den Ausstattungsverzeichnissen auch praktische Hinweise zur Aufbewahrung von Medikamenten und Medizinprodukten an Bord. Die Reeder müssen die Änderungen erst bei der nächsten jährlichen Überprüfung der medizinischen Ausstattung umsetzen.
Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Rubrik "Maritime Medizin". Die zusammengefassten Änderungen gegenüber dem vorherigen Stand der medizinischen Erkenntnisse haben wir in einem Informationsblatt zusammengestellt.
Jetzt verfügbar: Verwendungs-Nachweis Lohnnebenkosten 2022
Nachdem viele Fischer an der deutschen Ostseeküste wegen der drastischen Quotenkürzungen ihren Betrieb einstellen, bangen jetzt auch die rund 200 Krabbenfischer an der Nordsee um ihre wirtschaftliche Zukunft. Ein neuer Aktionsplan der EU-Kommission sieht das Verbot der Fischerei mit Grundschleppnetzen in Meeresschutzgebieten vor – genau dort, wo die wichtigsten Fanggründe der Krabbenfischer liegen. (21.03.2023)
Am 21. Februar hat die EU-Kommission ihren Aktionsplan "Schutz und Wiederherstellung von Meeresökosystemen für eine nachhaltige und widerstandsfähige Fischerei" vorgelegt. Würde dieser Plan Realität werden, hätte er weitreichende Auswirkungen für die deutsche Fischerei. Vor allem die knapp 200 Krabbenfischer-Betriebe in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sehen in dem Aktionsplan ihre wirtschaftliche Existenz bedroht. Dirk Sander, Vorsitzender des Landesfischereiverbandes Weser-Ems, drückt es drastisch aus: „Wenn das durchgeht, ist es aus. Von uns wird hier nix übrig bleiben".

Was steht drin im EU-Aktionsplan?
In ihrem Aktionsplan fordert die EU-Kommission die EU-Mitgliedsstaaten auf, die Fischerei mit Grundschleppnetzen
- in Natura-2000-Gebieten bis Ende März 2024 und
- in allen Meeresschutzgebieten der EU bis spätestens 2030
zu verbieten. Dazu sollen die EU-Mitgliedsstaaten ihre nationalen Maßnahmen bereits bis Ende März 2024 verabschiedet haben und der EU-Kommission einen konkreten Fahrplan für die schrittweise Einstellung der Grundschleppnetz-Fischerei bis 2030 in allen EU-Meeresschutzgebieten vorlegen.
Warum gibt es Kritik an Grundschleppnetzen?
Grundschleppnetze sind Fischnetze, die den Meeresgrund berühren. Umweltschützer kritisieren diese Art der Fischerei, da sie in Verdacht steht, den Meeresboden zu schädigen. Die EU-Kommission beruft sich in ihrem Aktionsplan auf ein Gutachten des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES), nach der die Fischerei "die menschliche Tätigkeit auf dem bzw. im Meer ist, die den Meeresboden im größten Umfang schädigt". Der Meeresboden ist laut EU-Kommission wichtig für die biologische Vielfalt sowie als CO2-Speicher zur Eindämmung des Klimawandels. Außerdem falle bei der Fischerei mit Grundschleppnetzen unverhältnismäßig viel Beifang an, so die EU-Kommission (vgl. Seiten 10ff. des EU-Aktionsplans).
 Das bundeseigene Thünen-Institut für Ostseefischerei verweist auf der von ihr betriebenen Website fischbestaende-online.de darauf, dass speziell die Krabbenfischerei fast ausschließlich mit leichteren Baumkurren ohne Ketten durchgeführt wird, die relativ wenig Druck auf den Meeresboden ausübt. Außerdem: "Die Garnelen-Fischerei findet in der Regel auf sandigem Grund statt, der meist durch starke (Tiden-)Strömungen gekennzeichnet ist. Zusätzliche Störungen durch Garnelenkurren sind daher meistens gering und nur temporär."
Das bundeseigene Thünen-Institut für Ostseefischerei verweist auf der von ihr betriebenen Website fischbestaende-online.de darauf, dass speziell die Krabbenfischerei fast ausschließlich mit leichteren Baumkurren ohne Ketten durchgeführt wird, die relativ wenig Druck auf den Meeresboden ausübt. Außerdem: "Die Garnelen-Fischerei findet in der Regel auf sandigem Grund statt, der meist durch starke (Tiden-)Strömungen gekennzeichnet ist. Zusätzliche Störungen durch Garnelenkurren sind daher meistens gering und nur temporär."
Was sind Natura 2000-Gebiete?
Natura 2000-Gebiete bilden ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten innerhalb der EU. Das Ziel dieser Natura 2000-Gebiete ist der Schutz gefährdeter wildlebender Pflanzen und Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen. Die Rechtsgrundlagen auf europäischer Ebene sind die Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG und Fauna-Flora-Habitat Richtlinie 92/43/EWG. In Deutschland gibt es insgesamt zehn Natura 2000-Schutzgebiete. In der Nordsee sind dies die Gebiete Doggerbank, Sylter Außenriff, Borkum-Riffgrund und Östliche Deutsche Bucht (siehe Karte der Natura 2000-Gebiete in der Nordsee).
Warum sehen die Fischer ihre Existenz durch den EU-Aktionsplan bedroht?
Knapp die Hälfte (45,5%) aller deutschen Meeresgewässer sind Natura 2000-Gebiete; im EU-Durchschnitt sind es dagegen nur 8,9% (wenn man noch die sonstigen Meereschutzgebiete hinzuzählt, sind es 12% in der EU). Würde der EU-Aktionsplan Realität, dürften Krabbenfischer zukünftig nicht mehr in den Meeresschutzgebieten fischen. Mit der Amrum-Bank, die Teil des Natura 2000-Gebietes "Sylter Außenriff" ist, würde eines der Hauptfanggebiete der Krabbenfischer ersatzlos wegfallen. Hinzu kommen die immer größer werdenden Flächen für Offshore-Windparks, die für die Fischerei gesperrt sind. Im Ergebnis würden für die Krabbenfischer kaum noch Fanggebiete übrigbleiben; auf einer Karte des BSH kann man das gut erkennen. Die Folge wäre, dass wahrscheinlich die meisten deutschen Krabbenfischer ihren Betrieb einstellen müssten. Der EU-Aktionsplan selbst enthält keine Abschätzung der Auswirkungen auf die Fischerei.
Gibt es in der Krabbenfischerei Alternativen zu Grundschleppnetzen?
Für die Krabbenfischerei gibt es derzeit keine Alternativen zu Grundschleppnetzen. Dirk Sander, Vorsitzender des Landesfischereiverbandes Weser-Ems, formuliert es so: „Du kannst keine Krabbe im Wattenmeer und wo auch immer mit Netzen fischen, die nicht am Grund sind. Angeln kann man sie auch nicht“. Eine andere mögliche Alternative, der Einsatz von neuartigen Pulsbaumkurren, bei denen die Krabben statt mit Rollen durch ein schwaches elektrisches Feld in das Netz gescheucht werden, hat die EU zum 1. Juli 2021 verboten.
Wie bewertet die deutsche Wissenschaft die Fischerei mit Grundschleppnetzen?
 Für die deutsche Nord- und Ostsee gibt es noch keine abschließenden Bewertungen zur Grundschleppnetz-Fischerei. Ein dreijähriges Forschungsprojekt der Deutschen Allianz für Meeresforschung, das in zwei sogenannten Pilotmissionen den Einfluss der Grundschleppnetz-Fischerei auf Meeresschutzgebiete in der Nordsee und in der Ostsee untersuchen soll, ist vor kurzem zu Ende gegangen. Noch liegt kein Abschlussbericht vor. Auf der Website des Nordsee-Forschungsprojektes ist unter "Ergebnisse" zu lesen, dass die Spuren der Schleppnetze auf dem Meeresboden bereits nach wenigen Monaten wieder verschwinden: "Die Sedimente scheinen sich, bewegt durch Meeres-Strömungen, relativ schnell wieder einzuebnen".
Für die deutsche Nord- und Ostsee gibt es noch keine abschließenden Bewertungen zur Grundschleppnetz-Fischerei. Ein dreijähriges Forschungsprojekt der Deutschen Allianz für Meeresforschung, das in zwei sogenannten Pilotmissionen den Einfluss der Grundschleppnetz-Fischerei auf Meeresschutzgebiete in der Nordsee und in der Ostsee untersuchen soll, ist vor kurzem zu Ende gegangen. Noch liegt kein Abschlussbericht vor. Auf der Website des Nordsee-Forschungsprojektes ist unter "Ergebnisse" zu lesen, dass die Spuren der Schleppnetze auf dem Meeresboden bereits nach wenigen Monaten wieder verschwinden: "Die Sedimente scheinen sich, bewegt durch Meeres-Strömungen, relativ schnell wieder einzuebnen".
Das deutsche Thünen-Institut für Ostseefischerei untersucht in einem von 2020 bis 2026 laufenden Großprojekt die Auswirkungen von Grundschleppnetzen in den deutschen Natura 2000-Schutzgebieten in der Ostsee. Auch hier liegen noch keine abschließenden Ergebnisse vor.
Wie sieht die deutsche Politik den EU-Aktionsplan?
Die deutschen Landwirtschaftsminister sehen den EU-Aktionsplan kritisch:
- Die Agrar- und Fischereiminister der Länder Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, Werner Schwarz (CDU) und Dr. Till Backhaus (SPD) haben in einem Schreiben an das Bundeslandwirtschaftsministerium deutliche Kritik an dem EU-Aktionsplan geübt und gefordert, sich für den Fortbestand der Fischerei einzusetzen (Pressemitteilung vom 10.3.).
- Auch die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) hat in einem Gespräch mit niedersächsischen Krabbenfischern betont, dass ein pauschales Verbot von Grundschleppnetzen in Schutzgebieten nicht die Lösung sein könne (Pressemitteilung vom 16.3.).
- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein undifferenziertes Pauschalverbot von Grundschleppnetzen nicht als richtigen Weg, denn das hätte gravierende Folgen für die deutsche Krabbenfischerei.
Wie geht es jetzt weiter?
Die Fischer haben massiven Protest gegen die Pläne der EU-Kommission angekündigt. Der deutsche Vertreter im Fischereiausschuss des EU-Parlaments, Niclas Herbst (CDU), hat einen Initiativbericht zum EU-Aktionsplan angekündigt. Damit wird sich dann auch das bisher nicht beteiligte Europäische Parlament mit dem EU-Aktionsplan befassen. Die EU-Kommission will den EU-Mitgliedsstaaten bereits in diesem Frühjahr "ein Muster und Leitlinien für die Ausarbeitung der Fahrpläne zur Verfügung stellen". Im Herbst dieses Jahres soll es die erste Sitzung der neuen Sondergruppe mit Vertretern aller EU-Mitgliedstaaten geben, um "Verfahren zur Nachverfolgung einzuleiten." Bis Ende März 2024 sollen die EU-Mitgliedsstaaten der EU-Kommission ihre Fahrpläne vorlegen und darlegen, wie sie die Ziele des Aktionsplans erreichen wollen.
Hintergrundinfos:
- Die Krabbenfischerei verwendet Grundschleppnetze, die mit einer acht bis zehn Meter langen stählernen Querstange, dem Kurrbaum, offengehalten werden. An beiden Enden des Kurrbaums befinden sich kufenartige Schuhe, mit denen das Netz über den Meeresboden gleitet. Zwischen diesen sogenannten Kurrschuhen sind mit Kettengliedern verbundene Hartgummirollen angeschlagen, deren Druckwellen die am Boden lebenden Krabben aufscheuchen und sie in das Fangnetz treiben.
- Die Küstengewässer erstrecken sich in einem Abstand bis 12 Seemeilen (ca. 22 km) von der Küstenlinie, die sich daran anschließende Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) in einem Bereich von 12 Seemeilen bis 200 Seemeilen vor der Küste.
- Der aktuelle Aktionsplan der EU-Kommission zur Fischerei ist nicht Teil eines formalen EU-Gesetzgebungsverfahrens; deshalb sind das EU-Parlament und der Europäische Rat bisher noch nicht in den Plan eingebunden worden. Der 29-seitige Aktionsplan besteht aus einer "Mitteilung" der EU-Kommission, mit der die EU-Mitgliedsstaaten zu konkreten Maßnahmen – unter anderem zum Verbot der Grundschleppnetz-Fischerei in Meeresschutzgebieten – aufgefordert werden.
Am 1. März 2023 hat Helge Heegewaldt sein Amt als Präsident und Professor des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) angetreten. Der 46-jährige Volljurist ist der Präsidentin und Professorin Dr. Karin Kammann-Klippstein gefolgt, die Ende des Jahres 2022 in den Ruhestand wechselte. (01.03.2023)
 „Das BSH ist eine sehr vielfältige, gut vernetzte und bestens aufgestellte Behörde. Ihr Spektrum reicht von zahlreichen Aufgaben im Bereich der Seeschifffahrt über die Unterstützung des beschleunigten Ausbaus der Offshore-Windenergie, die Meereskunde bis hin zur nautischen Hydrographie. Es umfasst damit für die Zukunft besonders bedeutsame Themen für unser Land. Von der Zukunftsfähigkeit dieser zentralen maritimen Behörde hängt viel ab, gerade bei der Umsetzung der Energiewende, aber auch in allen Fragen der Digitalisierung im maritimen Bereich und des Meeresschutzes. Daher bin ich sehr dankbar, als zukünftiger Leiter des BSH einen Beitrag zu einem erfolgreichen Gelingen dieser wichtigen Aufgaben zu leisten. Ich freue mich sehr auf die kommenden Herausforderungen und auf ein tolles Team in Hamburg und Rostock.“, betonte Helge Heegewaldt anlässlich seines Dienstantrittes.
„Das BSH ist eine sehr vielfältige, gut vernetzte und bestens aufgestellte Behörde. Ihr Spektrum reicht von zahlreichen Aufgaben im Bereich der Seeschifffahrt über die Unterstützung des beschleunigten Ausbaus der Offshore-Windenergie, die Meereskunde bis hin zur nautischen Hydrographie. Es umfasst damit für die Zukunft besonders bedeutsame Themen für unser Land. Von der Zukunftsfähigkeit dieser zentralen maritimen Behörde hängt viel ab, gerade bei der Umsetzung der Energiewende, aber auch in allen Fragen der Digitalisierung im maritimen Bereich und des Meeresschutzes. Daher bin ich sehr dankbar, als zukünftiger Leiter des BSH einen Beitrag zu einem erfolgreichen Gelingen dieser wichtigen Aufgaben zu leisten. Ich freue mich sehr auf die kommenden Herausforderungen und auf ein tolles Team in Hamburg und Rostock.“, betonte Helge Heegewaldt anlässlich seines Dienstantrittes.
Heegewaldt verfügt über breite berufliche Erfahrungen im politiknahen Bereich, in der Zusammenarbeit von Bund und Ländern sowie in der Ministerialverwaltung.
Vor seinem Wechsel in das BSH war Heegewaldt im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in unterschiedlichen Funktionen tätig. Zuletzt leitete er das Personalreferat des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Berlin und Rom sowie dem juristischen Vorbereitungsdienst am Kammergericht Berlin und an der Deutschen Botschaft in Washington DC arbeitete er zunächst in der Bürgerberatung der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin. Im Anschluss war er in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Büro des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers tätig. Dort war er neben der Europakoordinierung zur Umsetzung des Lissabon-Vertrages vor allem für die Verhandlungen im Vermittlungsausschuss mit den Ländern bei der Suche nach Kompromissen in laufenden Gesetzgebungsverfahren zuständig. Anschließend begleitete er im Referat für Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vor allem im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages und des Bundesrates die Gesetzgebungsvorhaben des Bundesumweltministeriums. Das betraf auch die Gesetzgebungsvorhaben zur Energiewende. Als persönlicher Referent zunächst im Bundesumweltministerium bereitete er die parlamentarische Staatssekretärin insbesondere in den Themen Energiewende und Klimaschutz, Wasserwirtschaft, Abfall und Ressourcenschutz, Umwelt und Gesundheit, Chemikaliensicherheit sowie in den Themen nationale und internationale Umweltpolitik vor.
Er wechselte mit der parlamentarischen Staatssekretärin vom Bundesumweltministerium in das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Dort bereitete er sie unter anderem auf Themen der Elektromobilität und Verkehrssicherheit sowie weitere Verkehrsthemen vor.
Als Leiter des Referats Politische Planung im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wirkte er bei der Vorhabenplanung des Ministeriums mit und bereitete den Minister auf Termine im parlamentarischen und außerparlamentarischen Raum vor. Schließlich verantwortete er als Leiter des Referats Personalverwaltung und Stellenbewirtschaftung im Bundesministerium für Digitales und Verkehr die Themen Personalverwaltung, Beförderungsplanung, Beurteilungsverfahren, Personalgewinnung, Ausbildung, Personalentwicklung sowie die Auswahl von Führungskräften.
Helge Heegewaldt ist Dr. Karin Kammann-Klippstein gefolgt, die seit 2018 die maritime Behörde leitete. In ihre Zeit als Präsidentin fallen wichtige Weichenstellungen wie zum Beispiel die Grundlagenarbeit des BSH zum Erreichen der ambitionierten Ziele der Bundesregierung zum Ausbau der Offshore-Windenergie, aber auch die immer engere inhaltliche Vernetzung der unterschiedlichen Aufgabenbereiche innerhalb des BSH. Auch die konsequente nachhaltige Ausrichtung der BSH-Flotte hat sie verfolgt. Die Indienststellung des LNG-betriebenen, geräuscharmen, energieeffizienten Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiffes ATAIR fiel ebenso in ihre Zeit als Präsidentin wie die Einleitung des Beschaffungsverfahrens der Ersatzbauten der Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiffe DENEB und WEGA, die ab 2030 klimaneutral fahren sollen. Sie machte die Bedeutung einer nachhaltigen Schifffahrt für die Vereinbarkeit von Schutz der Meere und ihrer wirtschaftlich unverzichtbaren Nutzung deutlich. Zu diesem Zweck förderte sie auch nachdrücklich die Beteiligung des BSH an Forschungsprojekten sowohl zum Meeresschutz als auch zur stärkeren Automatisierung der Schifffahrt. Auch setzte sie sich für einen fairen Umgang mit den Seeleuten gerade auch in den schweren Zeiten von Corona ein. Als Mitglied des Deutschen Dekaden-Komitees der UN-Dekade für Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung 2021-2030 wird sie sich auch weiterhin für die Vereinbarkeit von nachhaltiger Nutzung und Schutz der Meere engagieren.
Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie ermöglichte sie innerhalb kürzester Zeit mit Hilfe der IT-Abteilung des BSH für die Mehrzahl der Arbeitsplätze im BSH die Tätigkeit im Home-Office und sicherte damit sowohl die nahtlose Weiterführung aller Aufgaben des BSH als auch größtmöglichen Schutz der Beschäftigten. Die Arbeitszeitmodelle des BSH, vor allem auch zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gelten inzwischen als vorbildlich sowohl in der Verwaltung als auch in der Wirtschaft.
Wie zufrieden sind Sie mit der Dienststelle Schiffssicherheit?
Mit einer Umfrage bitten wir, die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr, unsere Kundinnen und Kunden, unsere Arbeit zu beurteilen. Die Online-Befragung ist anonym und dauert maximal 5 Minuten. Vielen Dank, dass Sie uns mithelfen, in Zukunft noch besser zu werden!
Mit dem Link https://kundenbefragung.bg-verkehr.de/l/9PkjZbGG5zkS gelangen Sie zu unserer Kunden-Umfrage. Danke, dass Sie daran teilnehmen!
Die Kunden-Umfrage ist Teil unseres Qualitätsmanagements – wir sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.
Der Hamburger Fotograf Patrik Ludolph ist drei Wochen auf dem deutschflaggigen Containerschiff "Chicago Express" mitgefahren. Das Ergebnis: Eine beeindruckende Reportage über die Arbeits- und Lebensbedingungen an Bord. Der 40-minütige Film gibt Einblicke in die eigene Welt eines Containerschiffes und zeigt die Bedeutung der Seefahrt für den weltweiten Handel. (21.02.2023)
Wie wird heute navigiert? Ab welchem Rollwinkel macht es Spaß? Wie ist das Leben als Seefahrer? Diese und andere Fragen beantwortet der neue Film "Chicago Express".
Schon sechsmal ist der Hamburger Fotograf Patrik Ludolph auf Seeschiffen mitgefahren. Dieses Mal ging der Bildermacher in Genua an Bord des Containerschiffes "Chicago Express", um nach drei Wochen Fahrt durch das Mittelmeer und über den Atlantik jede Menge Foto- und Filmmaterial mit nach Hause zu nehmen. Fünf Wochen benötigte Ludolph für den Schnitt des Films, der seit kurzem auf YouTube zu sehen ist.

"Chicago Express" ist ein bemerkenswertes Porträt der modernen Seefahrt. Da ist zum einem das Schiff selbst: 336 Meter lang, 8.600 Container tragend (O-Ton des Kapitäns: "schöne handliche Größe"), unter deutscher Flagge fahrend und mit einem eigenen Ausbildungsdeck für bis zu 20 Auszubildende.
Im Vordergrund des Films stehen die Menschen an Bord. Die komplette Crew, vom Kapitän bis zum philippinischen Oiler, wird mit Fotos vorgestellt. Wie an Bord gearbeitet und gelebt wird, erklären die europäischen Offiziere und der philippinische Bootsmann selbst. Da ist der 34-jährige Kapitän Claas Heinrich Hurdelbrink, der deutlich macht, welche immense Bedeutung die Seeschifffahrt für die Logistikketten hat: "Wenn die Schifffahrt ins Stocken gerät, kommt alles im Welthandel außer Kontrolle." Der Erste Offizier Steffen de Vries berichtet, dass praktisch alles an Ladung an Bord verschifft wird, was in einen Container passt - sogar Mineralwasser aus Italien, das nach dem Seetransport in New Yorker Feinkostläden verkauft wird. Und der philippinische Bootsmann Efren Nuyat erzählt von seinem harten und entbehrungsreichen Seefahrer-Leben, das ihm ein gutes Einkommen und damit eine hervorragende Ausbildung seiner Kinder ermögliche.
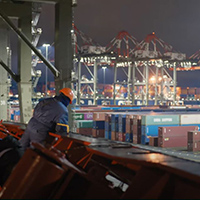
In 17 kurzweiligen Kapiteln geht der Filmemacher Patrick Ludolph auf alle wichtige Themen an Bord eines Seeschiffes ein – von der Ladung und der Stabilität des Schiffes über die fast 50.000 PS der Hauptmaschine, die fast so groß ist wie ein vierstöckiges Haus, bis hin zur Brücke und der Frage, ob es noch Papier-Seekarten an Bord gibt. Gezeigt wird der Alltag an Bord: Das ständige Rostklopfen und Streichen, um das Schiff vor dem aggressiven Salzwasser zu schützen, aber auch Barbecue und Kicker-Turniere in der freien Zeit an Bord.
Dem Film merkt man die Begeisterung des Filmemachers Patrick Ludolph für die Seefahrt und sein echtes Interesse an den Seeleuten an. Gerade die Statements der interviewten Seeleute ergeben ein unverfälschtes Bild fernab der Seefahrer-Romantik. Dass der Profi-Fotograf Ludolph zudem ein gutes Auge für eindrucksvolle Bilder hat, zeigen die Filmszenen vom Brechen der Wellen am Bug oder die auf den ersten Blick beängstigenden Verwindungsbewegungen innerhalb des Schiffes im Seegang.
Patrick Ludolph hat seinen Film den Seefahrern gewidmet, die dafür sorgen, dass wir alles überall kaufen können. So lautet sein Fazit am Ende des Films: "Die Crew eines Containerschiffes bekommen wir nie zu Gesicht. Und dennoch ist unser Alltag geprägt von den Waren, die in einer Blechbox über die Weltmeere zu uns gebracht wurden. Schaut Euch mal zu Hause um und klebt an jedes Produkt, das über's Schiff kam, ein Post-it. Eure Wohnung wäre wahrscheinlich verdammt gelb."

Der Film "Chicago Express" ist am 18. Februar 2023 im Hamburger Abaton-Kino uraufgeführt worden und ist auf YouTube frei zugänglich. In dem gesonderten Video "Eure Fragen & Behind the Scenes" gibt Patrick Ludolph, über eine Stunde lang Einblicke in die Entstehung des Films und erklärt weitere Details aus dem Arbeiten und Leben an Bord eines Containerschiffes.
Patrick "Paddy" Ludolph, wurde 1972 in Bielefeld geboren und studierte Informatik und Wirtschaftswissenschaften. 2006 startete er mit seinem Fotografie-Blog "Neunzehn72.de", in dem er bis heute über seine aktuellen Projekte berichtet. 2010 gab er seinen Job im Online-Marketing auf, um fortan als freier Fotograf zu arbeiten. 2017 veröffentlichte Ludolph seinen Bildband "Seafarers", der 160 Fotos von seiner sechswöchigen Fahrt auf drei Containerschiffen von Asien über Südamerika bis nach Europa enthält. Die Reportage "Chicago Express" ist sein erstes größeres Filmprojekt.
Die "Chicago Express" ist eines von zwei Ausbildungsschiffen der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. An Bord werden Schiffsmechaniker und Offiziersassistenten ausgebildet. Die weltweit tätige Reederei betreibt alle in ihrem Eigentum befindlichen Containerschiffe unter deutscher Flagge.
Aktuell bietet das öffentlich-rechtliche Fernsehen gleich zwei interessante Reportagen aus der deutschen Seefahrt. Der Film "Die Seefrau" aus der ZDF-Reportage-Reihe 37° beschreibt den Werdegang einer jungen Ostfriesin, die ihre Berufung als Krabbenfischerin gefunden hat. Die NDR-Reportage "Nordseelotsen im Sturm" begleitet zwei Seelotsen bei ihrer Arbeit an Bord eines Autofrachters und beim Übersteigen auf das Lotsenboot im heftigen Sturm. (17.02.2023)
ZDF-Reportage "Die Seefrau" über eine junge Krabbenfischerin
 Die ZDF-Reportage "Die Seefrau" beschreibt den bisherigen Lebensweg der jetzt 24-jährigen Anna-Lena Jacobs aus Neuharlingersiel. Als 17-jährige begann Anna-Lena Jacobs die Ausbildung als Fischwirtin auf dem Krabbenkutter "Edelweiss" aus Bensersiel. Nach vier Wochen brach sie diese Ausbildung ab, als sie ihren Freund kennenlernte. An Land machte sie eine Ausbildung als Land- und Baumaschinen-Mechatronikerin, die sie 2019 erfolgreich abschloss. Anschließend fuhr sie ein halbes Jahr als Decksfrau auf dem Krabbenkutter "Edelweiss", bevor sie sich dann bei der Reederei Norden-Frisia zur Schiffsmechanikerin ausbilden ließ. Jetzt will sie ihr Küstenfischerei-Patent machen und später den Krabbenkutter "Gorch Fock" ihres Vater Willi Jacobs übernehmen.
Die ZDF-Reportage "Die Seefrau" beschreibt den bisherigen Lebensweg der jetzt 24-jährigen Anna-Lena Jacobs aus Neuharlingersiel. Als 17-jährige begann Anna-Lena Jacobs die Ausbildung als Fischwirtin auf dem Krabbenkutter "Edelweiss" aus Bensersiel. Nach vier Wochen brach sie diese Ausbildung ab, als sie ihren Freund kennenlernte. An Land machte sie eine Ausbildung als Land- und Baumaschinen-Mechatronikerin, die sie 2019 erfolgreich abschloss. Anschließend fuhr sie ein halbes Jahr als Decksfrau auf dem Krabbenkutter "Edelweiss", bevor sie sich dann bei der Reederei Norden-Frisia zur Schiffsmechanikerin ausbilden ließ. Jetzt will sie ihr Küstenfischerei-Patent machen und später den Krabbenkutter "Gorch Fock" ihres Vater Willi Jacobs übernehmen.
Die 27-minütige lange Reportage enthält viele stimmungsvolle Aufnahmen von der Arbeit der Krabbenfischer und ostfriesischen Kapitäns-Originalen. Der Film ist ein sehr persönliches Porträt einer jungen zupackenden Frau, die mit der Seefahrt aufgewachsen ist und ihre Berufung als Krabbenfischerin gefunden hat.
Der Film "Die Seefrau" ist in der ZDF-Mediathek unter diesem Link abrufbar.
NDR-Reportage "Die Nordseelotsen im Sturm"
Der NDR hat Mitte Januar zwei Seelotsen bei ihrer Arbeit auf dem Autotransporter "Silver Soul" vom Emder Hafen bis zur Ansteuerung Westerems draußen in der Nordsee begleitet. Die Herausforderung beginnt schon im Hafen: Der Hafenlotse Gerhard Janßen, Ältermann der Lotsenbrüderschaft Ems, berät den Kapitän, wie er sein Schiff bei heftigen Windböen von der Kaikante wegbekommt. Sein Lotsenkollege Dominik Thieben übernimmt dann die weitere Lotsberatung auf der Ems bis hinaus auf die offene Nordsee. Während der Fahrt nimmt der Sturm an Heftigkeit zu und erreicht in Böen bis zu Windstärke 11. Nordwestlich von Borkum folgt dann der kritischste Moment: Das Übersetzen der beiden Lotsen vom Autofrachter über die Lotsenleiter auf den Lotsentender – und das bei rund vier Meter hoher Welle und orkanartigen Böen.
Wie gefährlich das Übersetzen gerade im Sturm ist, zeigt ein Vorfall, der sich nur sieben Stunden nach dem Abschluss der TV-Aufnahmen ereignete: Am frühen Sonntagmorgen des 15. Januar fiel an gleicher Stelle ein Lotse beim Übersteigen vom zu lotsenden Schiff in die stürmische Nordsee. Trotz Dunkelheit und meterhohem Seegang gelang es der Besatzung des Lotsentenders "Borkum", den 47-jährigen Lotsen nach rund 15 Minuten wieder an Bord zu bekommen.
Die 28-minütige Reportage "Nordseelotsen im Sturm" ist in der NDR-Mediathek unter diesem Link verfügbar.
Zur See zu fahren ist in den meisten Fällen nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Aber manchmal gibt es durch beruflich bedingte oder private Umstände Situationen, in denen sich Seeleute psychisch extrem belastet fühlen. Die Seemannsmissionen und die Trauma-Lotsen der BG Verkehr bieten Hilfe in solchen Fällen. (07.02.2023)
 Psychische Belastungen von Seeleuten können viele Ursachen und Auswirkungen haben. Manchmal sind es fehlende Landgänge, der nur sehr eingeschränkte Kontakt zur Familie oder Heimweh, in anderen Fällen der dauernde Stress und Übermüdung, die auf die Psyche von Seeleuten drücken. Schwere Unfälle, Havarien oder Piraterie-Überfälle können sogar zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Umso wichtiger in solchen Fällen sind konkrete Hilfe-Angebote für Seeleute.
Psychische Belastungen von Seeleuten können viele Ursachen und Auswirkungen haben. Manchmal sind es fehlende Landgänge, der nur sehr eingeschränkte Kontakt zur Familie oder Heimweh, in anderen Fällen der dauernde Stress und Übermüdung, die auf die Psyche von Seeleuten drücken. Schwere Unfälle, Havarien oder Piraterie-Überfälle können sogar zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Umso wichtiger in solchen Fällen sind konkrete Hilfe-Angebote für Seeleute.
Deutsche Seemannsmission: Psychosoziale Fachkräfte und www.dsm.care
Die Deutsche Seemannsmission hat den Großteil ihrer Mitarbeitenden - vor allem Diakoninnen und Diakone - zu Psychosozialen Fachkräften ausgebildet. Diese in Deutschland und im Ausland eingesetzten Fachkräfte haben eine Ausbildung in Psychosozialer Notfallversorgung (PSNV) durchlaufen und kennen den Umfang mit Seeleuten aus ihrer täglichen Praxis der Bordbetreuung und in den Seemannsclubs. Diese Fachkräfte sind unter der Notfall-Telefon-Nummer +49 40 328 902 440 rund um die Uhr erreichbar.
Ebenfalls 24/7 erreichbar ist das Angebot DSM care. Unter https://www.dsm.care/ bietet die Deutsche Seemannsmission die Möglichkeit für Seeleute, mit einem Diakon/einer Diakonin im vertraulichen Rahmen zu chatten.
In Deutschland gibt es 18 Seemanssmisionen (16 von der (evangelischen) Deutschen Seemannsmission, 2 von der katholischen Seemannsmission Stella Maris), im Ausland weitere Stationen. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Website.
BG Verkehr: Trauma-Lotsen
Die BG Verkehr hat Sachbearbeiter/-innen aus der Unfallabteilung zu sogenannten "Trauma-Lotsen" ausgebildet. Hauptaufgabe dieser Trauma-Lotsen ist es, sehr schnelle Behandlungsmöglichkeiten bei externen Psychotherapeuten zu vermitteln. An solche Termine bei Therapeuten heranzukommen, ist sonst sehr schwierig. Für die Seeschifffahrt sind die Trauma-Lotsen der Bezirksverwaltung Hamburg der BG Verkehr zuständig (Telefon-Nummer: 040/325 220 – 28 20).
Die Trauma-Lotsen der BG Verkehr sind für alle Versicherten in Unternehmen der BG Verkehr zuständig – also auch zum Beispiel für Speditions- oder Luftfahrt-Unternehmen. Im Seeschifffahrtsbereich richtet sich das Angebot der Trauma-Lotsen an alle Reedereien mit Schiffen unter deutsche Flagge und/oder für Seeleute mit einer sog. Ausstrahlungsversicherung (deutsche Seeleute mit Wohnsitz in Deutschland auf Seeschiffen unter ausländischer Flagge). In einem Beitrag im "SicherheitsProfi" der BG Verkehr finden sich mehr Informationen zur Bewältigung von Extremereignissen und zu den Trauma-Lotsen.
Übrigens: Auf unserer Website geben wir in der Rubrik "Notfall an Bord" praktische Tipps und Kontaktdaten für das Notfall-Management an Bord von Seeschiffen unter deutscher Flagge.
Wer auf Seeschiffen arbeitet, muss rundum fit sein und dies durch ein Seediensttauglichkeitszeugnis nachweisen können. Für das vergangene Jahr verzeichnete der Seeärztliche Dienst der BG Verkehr über 14.000 Seediensttauglichkeitsuntersuchungen. Und falls doch mal ein Notfall geschieht, unterstützt das Medizinische Handbuch See die bestmögliche Behandlung an Bord. (07.02.2023)
 Die Zahl an Seediensttauglichkeitsuntersuchungen hat voriges Jahr fast wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht: 2022 haben die vom Seeärztlichen Dienst zugelassenen Ärzte und Ärztinnen insgesamt 14.134 Seediensttauglichkeitsuntersuchungen im In- und Ausland durchgeführt – das ist ein Plus von fast 11 Prozent gegenüber 2021. 6313 der Untersuchten wollten neu in die Seeschifffahrt einsteigen. Alle anderen waren erfahrene Seeleute, die ihr Seediensttauglichkeitszeugnis turnusmäßig erneuern lassen mussten.
Die Zahl an Seediensttauglichkeitsuntersuchungen hat voriges Jahr fast wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht: 2022 haben die vom Seeärztlichen Dienst zugelassenen Ärzte und Ärztinnen insgesamt 14.134 Seediensttauglichkeitsuntersuchungen im In- und Ausland durchgeführt – das ist ein Plus von fast 11 Prozent gegenüber 2021. 6313 der Untersuchten wollten neu in die Seeschifffahrt einsteigen. Alle anderen waren erfahrene Seeleute, die ihr Seediensttauglichkeitszeugnis turnusmäßig erneuern lassen mussten.
Insgesamt erwiesen sich 252 Männer und Frauen als nicht seediensttauglich, die Mehrzahl von ihnen hatte sich zum ersten Mal beworben. Mit 1,78 Prozent entspricht die Untauglichkeits-Quote bei den Untersuchungen ungefähr den Ergebnissen der letzten Jahre.
In den meisten Fällen waren die Augen Schuld an der Untauglichkeit: Ungenügendes Seh- oder Farbunterscheidungsvermögen sind Ausschlusskriterien für den Dienst an Bord. In absteigender Reihenfolge folgten psychiatrische Erkrankungen, Herz- und Kreislauferkrankungen und Übergewicht. Weitere Ausschlusskriterien – dazu gehören etwa neurologische Erkrankungen, schlechtes Hörvermögen oder der Missbrauch von Alkohol und Drogen - wurden deutlich seltener diagnostiziert.
Die Seediensttauglichkeitsuntersuchungen stellen sicher, dass kein Crew-Mitglied gesundheitlich vorbelastet ist. Dennoch lassen sich medizinische Notfälle auf See nie ganz ausschließen. Von Knochenbrüchen über Verbrühungen bis zum Herzinfarkt kann vieles passieren, und für die Versorgung ist dann der Kapitän oder ein nautischer Offizier zuständig. Damit diese medizinischen Laien im Notfall das Richtige tun, werden sie medizinisch geschult – zunächst während ihrer nautischen Ausbildung, später in regelmäßigen medizinischen Wiederholungslehrgängen. Auch für die Qualitätssicherung und Zulassung dieser Kurse ist der Seeärztliche Dienst verantwortlich – ebenso für die Inhalte des Medizinischen Handbuchs See, auf das die Lehrgänge Bezug nehmen und das fester Bestandteil der Bordapotheke ist. Die Lehrgänge und das Medizinische Handbuch See wurden 2022 – wie schon in den Vorjahren - von den Nautikern mit "gut" bis "sehr gut" bewertet und für ihren Praxisbezug gelobt.
Bei Seelotsen liegen die gesundheitlichen Anforderungen noch einmal höher, da ihre Tätigkeit eine besondere Bedeutung für die Sicherheit im Seeverkehr hat. 2022 wurden im Auftrag des Seeärztlichen Dienstes insgesamt 440 Seelotseignungsuntersuchungen durchgeführt, die Untauglichkeitsquote lag bei 5,7 Prozent.
An Bord eines niederländischen Segelschiffs kam es Anfang Januar zu einem tödlichen Unfall bei der sachgemäßen Verwendung einer Fallschirmrakete vom Typ L-35 / L-35A mit der Losnummer 0525/2021 – 113 des spanischen Herstellers Pirolec.
Das Produkt wurde bereits zurückgerufen, derzeit läuft die Unfalluntersuchung durch das Niederländische Amt für Sicherheit (Dutch Safety Board).
Falls Sie noch eine Fallschirmrakete des oben genannten Typs an Bord haben: Bitte verwenden Sie die Rakete wegen des großen Risikos nicht.
Hamburg Port Health Center zieht um
Der Hafen- und Flugärztliche Dienst (HÄD) Hamburgs, das Port Health Center Hamburg, zieht ab dem 23. Januar um von Hamm an einen neuen Standort in Rothenburgsort. Ab dem 6. Februar öffnet der neue Geschäftsort seine Türen auf dem Gelände des Instituts für Hygiene und Umwelt, an das der Hafenärztliche Dienst auch organisatorisch angegliedert ist.
Die neue Adresse lautet:
Marckmannstraße 129 b
20539 Hamburg
Telefonisch ist während des Umzugs der Hafenarzt in dringenden Fällen unter 0173 23 22 871 erreichbar.
Nach dem Umzug bleiben Telefonnummer und E-Mail unverändert:
Tel: +49 40 42 845 44 20
E-Mail: impfzentrum@hu.hamburg
Alle Hafenärztlichen Dienste finden Sie in dieser Übersicht.
Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek wird neuer Maritimer Koordinator der Bundesregierung. Das hat das Bundeskabinett jetzt beschlossen. Janecek folgt auf Claudia Müller, die in das Bundeslandwirtschaftsministerium gewechselt ist. (19.1.2023)
 Dieter Janecek ist seit 2013 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis München-West/Mitte. Der 46-Jährige ist wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion und Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Bundestags. Er hat sich bisher vor allem mit den Themen Klimaschutz, Energie- und Ressourceneffizienz und Mobilität beschäftigt.
Dieter Janecek ist seit 2013 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis München-West/Mitte. Der 46-Jährige ist wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion und Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Bundestags. Er hat sich bisher vor allem mit den Themen Klimaschutz, Energie- und Ressourceneffizienz und Mobilität beschäftigt.
In einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz wird Dieter Janecek mit folgenden Worten zitiert: "Mit Blick auf die maritime Wirtschaft sind es vor allem innovative Lösungen zur Dekarbonisierung der Seeschifffahrt, die wir vorantreiben müssen. Auch sehe ich in der maritimen Wirtschaft einen wichtigen Player und Akteur, den wir für den Aufbau von Produktionskapazitäten für den Offshore-Windausbau brauchen. Die Nationale Maritime Konferenz im September in Bremen wird für diese Themen ein wichtiger Meilenstein sein."
Dieter Janecek ist in Pirmasens (Pfalz) geboren und wuchs im bayerischen Eggenfelden auf. Er hat in München Politik studiert und arbeitete nach seinem Studium als PR-Berater. 2003 wurde er Referent für interne Kommunikation bei den Grünen in Bayern. 2008 wurde er Landesvorsitzender der bayerischen Grünen.
Das Amt des Koordinators der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus ist im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz angesiedelt. Zu den Aufgaben gehört die Koordinierung und Bündelung der Bundes-Aufgaben im Bereich der maritimen Wirtschaft, zu der die Meerestechnik, See- und Binnenschifffahrt, Hafenwirtschaft, maritime Zulieferindustrie und Fischerei gehören.
Die vormalige Maritime Koordinatorin Claudia Müller ist seit Jahresanfang Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
Die zentrale Leistung der Seemannskasse war und ist das Überbrückungsgeld, das Seeleute nach Beendigung ihrer aktiven Tätigkeit bis zum Beginn ihrer Altersrente erhalten. Stirbt der Bezieher, wird die Zahlung von Überbrückungsgeld eingestellt. Hinterbliebene hatten bislang keine finanzielle Hilfe der Seemannskasse erhalten. Mit dem neuen Jahr ändert sich das: Seit dem 1. Januar haben Hinterbliebene unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine Einmalzahlung der Seemannskasse in Höhe von 6.000 Euro. (13.01.2023)
 Die neue Leistung der Seemannskasse soll Angehörigen dabei helfen, die finanziellen Belastungen nach dem Trauerfall zumindest in der Anfangszeit ein bisschen abzufedern. Die Seemannskasse hat das Hinterbliebenengeld als "Einmalige Leistung wegen Todes" in ihre Satzung aufgenommen (§ 17a SSmk). Die Höhe des Hinterbliebenengeldes beträgt einheitlich 6.000 Euro.
Die neue Leistung der Seemannskasse soll Angehörigen dabei helfen, die finanziellen Belastungen nach dem Trauerfall zumindest in der Anfangszeit ein bisschen abzufedern. Die Seemannskasse hat das Hinterbliebenengeld als "Einmalige Leistung wegen Todes" in ihre Satzung aufgenommen (§ 17a SSmk). Die Höhe des Hinterbliebenengeldes beträgt einheitlich 6.000 Euro.
Dies sind die Voraussetzungen für die Zahlung des Hinterbliebenengeldes:
Die versicherte Person muss…
... am oder nach dem 01. Januar 2023 verstorben sein
... zum Zeitpunkt des Todes die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Bezug von Überbrückungsgeld erfüllt haben.
Der überlebende Partner muss…
... mit dem/der Verstorbenen rechtsgültig verheiratet oder verpartnerschaftet ("eingetragene Lebenspartnerschaft") gewesen sein.
... bei der Seemannskasse einen Antrag auf die Leistung stellen.
Weitere Infos zum Hinterbliebenengeld erhalten Sie auf der Website der Deutschen Rentenversicherung / Knappschaft-Bahn-See oder unter der kostenlosen Servicenummer 0800-1000 480 80.
Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hat vor kurzem Eilanträge abgelehnt, mit denen zwei Reedereien die Besetzung ihrer Wassertaxis mit nur einem Besatzungsmitglied erreichen wollten. Damit bestätigte das Oberverwaltungsgericht die vorhergehende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg, das eine Zwei-Personen-Besetzung von Wassertaxis für verhältnismäßig gehalten hatte. (12.01.2023)
Im ostfriesischen Wattenmeer fahren kleine Wassertaxis, mit denen jeweils bis zu 12 Personen von den Festlandshäfen zu den Inseln Juist, Spiekeroog und Baltrum hin- und hergefahren werden. Im Juni 2021 änderte das Bundesverkehrsministerium die Schiffsbesetzungsverordnung so, dass auch kleinere Schiffe mit 8 m Länge und weniger Schiffsbesatzungszeugnisse benötigen. Auf dieser Grundlage hatte die zuständige Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr für die Besetzung von Wassertaxis zwei Besatzungsmitglieder vorgeschrieben.
Dagegen wandten sich die zwei Wassertaxi-Betreiber von den Inseln Juist, Baltrum und Spiekeroog. Sie reichten Ende Oktober 2022 beim Verwaltungsgericht Hamburg zwei Eilanträge im sogenannten einstweiligen Rechtsschutzverfahren ein, mit dem sie für ihre Wassertaxis Schiffsbesatzungszeugnisse mit jeweils nur einem Schiffsführer beantragten. Das Verwaltungsgericht Hamburg lehnte beide Anträge am 27. Oktober 2022 ab.
Die beiden Reedereien legten daraufhin Beschwerde beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht ein. Dieses Gericht hat nun am 4. Januar 2023 entschieden und beide Beschwerden zurückgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht hat damit die vorhergehenden Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Hamburg bestätigt. Mit den beiden aktuellen Beschlüssen des Oberverwaltungsgerichts ist das vorläufige Rechtsschutzverfahren beendet.
Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hat 2023 zum "Jahr der Ausbildung" benannt. Passend dazu wurde der neue Referent für Ausbildung ein- und vorgestellt. Mit dem ehemaligen Geschäftsführer der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt, Holger Jäde, soll ein ausgewiesener Fachmann für neuen Schwung sorgen. (3.1.2023)
 Seit Anfang des Jahres verstärkt Holger Jäde das Team um VDR-Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Kröger. Jäde ist Nautiker und als Kapitän zur See gefahren. Nach beruflichen Stationen als Nautischer Sachbearbeiter bei der Marine in Wilhelmshaven, in unterschiedlichen Funktionen im Havariekommando in Cuxhaven, als Leiter der Außenstelle für Schiffssicherung in Neustadt/Holstein wurde er 2008 Geschäftsführer der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt in Bremen. Dort engagierte er sich elf Jahre für die Ausbildung von Schiffsmechanikern und Offiziersassistenten, bevor er 2019 wieder zum Havariekommando wechselte. Als Referent für Ausbildung wird sich Holger Jäde jetzt beim Verband Deutscher Reeder um das Thema Seeleute-Nachwuchs kümmern.
Seit Anfang des Jahres verstärkt Holger Jäde das Team um VDR-Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Kröger. Jäde ist Nautiker und als Kapitän zur See gefahren. Nach beruflichen Stationen als Nautischer Sachbearbeiter bei der Marine in Wilhelmshaven, in unterschiedlichen Funktionen im Havariekommando in Cuxhaven, als Leiter der Außenstelle für Schiffssicherung in Neustadt/Holstein wurde er 2008 Geschäftsführer der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt in Bremen. Dort engagierte er sich elf Jahre für die Ausbildung von Schiffsmechanikern und Offiziersassistenten, bevor er 2019 wieder zum Havariekommando wechselte. Als Referent für Ausbildung wird sich Holger Jäde jetzt beim Verband Deutscher Reeder um das Thema Seeleute-Nachwuchs kümmern.
Mit der Einstellung von Holger Jäde will der Reederverband die seemännische Ausbildung in der deutschen Seeschifffahrt stärken. Beim traditionellen Reederessen im Dezember kündigte VDR-Präsidentin Dr. Gaby Bornheim an, dass das Jahr 2023 unter dem Motto "Jahr der Ausbildung" stehen werde.
Ein Kurz-Porträt von Holger Jäde aus dem Jahr 2017 ist in unserer Rubrik "Menschen der deutschen Flagge" zu finden.